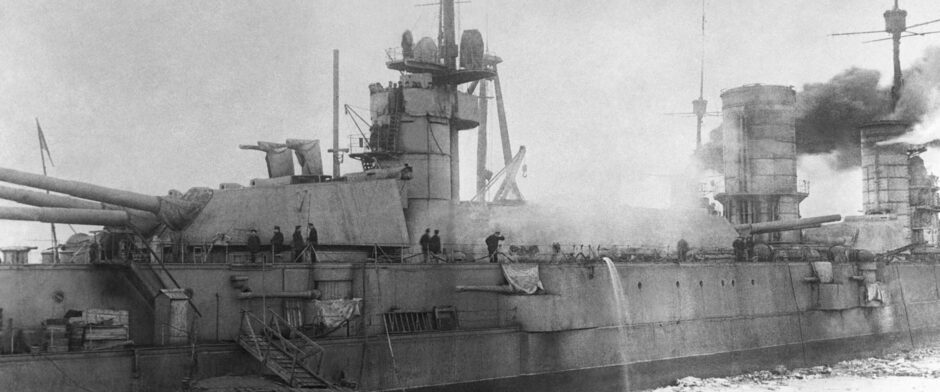Um im großen Fluss zu schwimmen, muss man spüren, wohin er fließt, vor allem, wenn er die Wüsten unterirdisch durchquert
(Aberto Magnaghi, Per un’idea di libertà)
Erste Prämisse:
Die „Krise der Militanz“ und die Notwendigkeit, mit neuen Formen zu experimentieren, ohne in Formalismus zu verfallen.
Die Feststellung, dass die traditionellen Formen der Militanz veraltet sind, ist heute selbstverständlich und bisweilen tautologisch. Es ist notwendig, wie bereits in einigen neueren Aufzeichnungen über Militanz1 hervorgehoben wurde, von der klassischen „Kritik der Militanz“ wegzukommen, die als Kritik Gefahr läuft, in einer wechselseitige Beziehung mit dem zu verbleiben, von dem sie sich separieren will. Dies erfordert vor allem den Versuch, sich jenseits jeglicher politischer Landkarte oder Topographie zu verorten, die die verschiedenen Gruppierungen dessen, was oft als „Bewegung“ bezeichnet wird, darstellt, ordnet und trennt, nicht auf eine einfache rhetorische Übung zu reduzieren.
Dies ist kein moralisches Problem, geschweige denn ein Identitätsproblem, sondern eine strategische Notwendigkeit, die so gründlich wie möglich ausgearbeitet, vertieft und ausprobiert werden muss. Es geht darum, jeder Art von strategischer Zugehörigkeit zu dem konfusen Wirrwarr ein Ende zu setzen, das die heutige Bewegung und den Aktivismus kennzeichnet. Es geht nicht um eine Rhetorik der „Neuartigkeit“.
Eine Theorie und eine Strategie entstehen nicht als „neues Wissen“, sondern aus Reflexionen, Selbstklärungsprozessen und Hypothesen, die sich in einer empirischen Beziehung zu den Kampfformen selbst bilden. Es geht also darum, aus bestimmten Bedürfnissen, aus der Identifizierung gegensätzlicher Lager, die zwischen Empirie und Abstraktion oszillieren, strategische Bahnen zu skizzieren.
Eine Strategie erfordert daher ein selbstreflexives Bewusstsein, das nichts mit dem Wiederholungszwang zu tun hat, der die zeitgenössischen Formen des unruhigen Aktivismus kennzeichnet, auch dann nicht, wenn diese Automatismen versuchen, sich in rhetorische Diskurse zu kleiden, die das Vokabular vergangener politischer Traditionen beimischen. In diesen Fällen haben wir es mit Formen der Selbstverleugnung durch einen performativen Gebrauch des Wortes zu tun, begleitet von einer schizophrenen Aktion, die auf dem ausgetretenen Pfad des aktuellsten Themas verbleibt, das eine öffentliche Debatte erregt.
Ein erstes Problem, das es zu verstehen gilt, ist, dass diese Formen stark an ein Politikverständnis gebunden sind, das mit dem der Öffentlichkeit übereinstimmt. Der Zwang ist ein doppelter: Einerseits wird davon ausgegangen, dass eine Organisation eine solche ist, wenn sie eine öffentlich nachgefragte und affirmierte Existenz hat. Dies geschieht in einer Mischung, die zwischen dem pathologischen Narzissmus der Militanten und dem taktischen, kurzlebigen Ziel oszilliert, „ansprechbar zu werden“: nicht so sehr von jenen, deren „Hunger nach Sinn“ sie dazu bringt, auf der Suche nach einer revolutionären Perspektive zu handeln und zu denken, sondern von jenen, die, verloren, nichts weiter tun, als sich an die zugänglichste und bequemste Form der Identität, der kulturellen oder ästhetischen Zugehörigkeit zu halten.
Diese Art von impliziter Strategie besteht darin, eine kontinuierliche öffentliche Exposition anzustreben, die darauf abzielt, die Kräfte so zu bündeln, dass ein siegreiches Kräftegleichgewicht gegenüber dem Staat und der Polizei geschaffen wird. Obwohl diese Strategie in der Vergangenheit für einige Bewegungen kennzeichnend war, ist es heute schwierig zu verstehen, wie, wo und wann sie angesichts eines erdrückenden Kräfteungleichgewichts wirksam sein soll.2
Die andere Seite dieses Zwangs besteht darin, das Handeln zu entmachten, weil man glaubt, dass man politisch handelt, wenn man öffentlich handelt. Die Aktion gilt als wirksam, wenn sie es ermöglicht, aus der Medienaufmerksamkeit für das eine oder andere Thema Kapital zu schlagen: all das ohne jegliche Überlegung, wie ein Sieg eines Kampfes aussehen könnte, wie er zu erreichen ist, wie er aufzubauen ist. Deshalb wird jede Niederlage in triumphalem Ton gefeiert.
So wird selbst eine der stärksten Formen des freien organischen Ausdrucks des Körpers, nämlich die Gewalt, anstatt eine intensive Erfahrung zu sein, die Beziehungen revolutionärer Freundschaft schmiedet und erprobt, Komplizenschaft nährt und die Konturen eines gemeinsamen Feindes nachzeichnet, zu einem spektakulären Werkzeug, das sich in einem ebenso absurden wie erbärmlichen Ende verliert. So wird die Gewalt zum Material für einen Bewegungsmanager oder „Parteiführer“ oder zur Pose eines anarchistischen Cosplayers.
Andererseits ist die Gewalt nicht alles, sie ist kein Zweck, sondern ein Mittel, das keinem Zweck unterworfen, sondern „situiert“ werden soll. Die Besonderheit der Gewalt, vor allem bei Riots, besteht darin, dass sie die ethischen Bindungen derer, die an ihr teilnehmen, verstärken kann: Jeder, der sie erlebt hat, weiß, dass die Komplizenschaften, die sich bei einem Riot oder einem Akt der Sabotage bilden, nicht die gleichen sind wie bei einem Camp oder einer Vokü. Dies darf jedoch nicht zu der Vorstellung verleiten, dass es eine Skala der Radikalität gibt, innerhalb derer die verschiedenen anzustrebenden Praktiken einzuordnen sind. Andernfalls läuft man Gefahr, sich einer absurden Rationalität zu unterwerfen, wie die derjenigen, die nichts anderes tun, als die Öffentlichkeit zu suchen, um einen Schein von Existenz zu ernähren, und sich einer nihilistischen Irrationalität zu unterwerfen, die die Aktion als Selbstzweck fetischisiert, selbst wenn sie selbstzerstörerisch ist. In keinem dieser Fälle ist Gewalt Freude und Handlungsmacht3, sondern traurige Selbstaufopferung.
Um über eine einfache „Kritik der Militanz“ (oder der Militanz, zu der sie heute degeneriert ist) hinauszugehen, müssen zwei Arten von Bemühungen in Betracht gezogen werden: der Aufbau starker ethischer und politischer Freundschaften auf der Basis solider inhaltlicher Grundannahmen, frei von Opportunismus, außerhalb eines PR-Plans. Von diesen ausgehend, von jenem ethischen Kern, den manche auch als Lebensform bezeichnen, kann die weitere Öffnung für Erfahrungen und weitere Komplizenschaften geschehen, die Kriterien folgen, die in der Lage sind, die Bereiche zu skizzieren, auf die die experimentellen Anstrengungen gerichtet werden sollten. Es geht also darum, ein strategisches Kriterium der Abgrenzung zu entwickeln, das nicht rein analytisch, sondern empirisch und abstrakt zugleich ist.
Um diese Überlegungen fortzusetzen, lohnt es sich, einen weiteren allgemeinen Gedankengang zu den Formen der zeitgenössischen Konfliktualität und des konfrontativen Handelns anzustellen.
Zweite Prämisse:
Es ist die Zeit der Non-Bewegungen und der destituierenden Aufstände
Die Notwendigkeit, mit neuen Organisationsformen zu experimentieren und zu den Wurzeln der Fragen nach Aktion und „Politik“ zurückzukehren, ist angesichts bestimmter symptomatischer Merkmale zeitgenössischer Formen der Auseinandersetzung und der Erfordernis, die Sackgassen klassischer ( auch „revolutionärer“) politischer Projekte zu überwinden, offensichtlich. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich kurz mit einigen Schlüsselkategorien der Konfliktinterpretation auseinanderzusetzen, die vorgebracht worden sind.
Eine der interessantesten ist die der „Non-Bewegungen“, die Bayat in seiner „Revolution ohne Revolution“ mit paradigmatischem Bezug auf den arabischen Frühling vorstellte und die später von Endnotes in „Onward Barbarians“ mit Bezug auf Ereignisse wie die Gelbwesten oder den die George Floyd-Revolte in den Vereinigten Staaten aufgegriffen und weiterentwickelt wurde.
Sehr oft folgt daraus ein offensichtliches Fehlen einer gemeinsamen Sprache, einer Reihe klarer und programmatisch ausgearbeiteter Forderungen, die als „Synthese“ fungieren können, und von Sprechern, die als Interpreten dieser Forderungen fungieren können und somit als Vermittler zwischen denjenigen, die auf die Straße gehen, und den politischen Entscheidungsträgern in Frage kommen (man denke an das Durcheinander von oftmals auch nicht realisierbaren Forderungen, die Erfahrungen wie die der „Gelbwesten“ oder der „Forconi“ in Italien kennzeichnet). Ebenso offensichtlich ist die Unmöglichkeit, zeitgenössische Konflikte anhand von „ orientierenden Identitäten “ oder durch die Vermessung soziologischer Knotenpunkte zu verstehen.4
Mit Hilfe einer marxistischen „Analyse“ beharrt Endnotes auf der Rolle der sozialen- und Klassenfragmentierung, aber man braucht keine politisch-ökonomische Analyse, um zu verstehen, dass nicht einmal die raffiniertesten Mystifizierungen oder die mächtigste Rhetorik in der Lage sein werden, den Massenarbeiter wieder zum Leben zu erwecken, der dem Operaismus so teuer ist, oder eine andere Art von Subjekt, dessen Homogenität vorausgesetzt werden kann. Diese Zersplitterung ohne einen nostalgischen Blick auf die guten alten Massensubjekte zu verstehen und nicht zu versuchen, sie durch konstruierte Mythen wieder zum Leben zu erwecken, ist eine Frage von gesundem Menschenverstand ebenso wie der Strategie.
Es geht darum, aus dem untergehenden Universalismus des Westens, aus der Zersplitterung des Westens selbst, revolutionäre Möglichkeiten neu zu erarbeiten. Der Arbeiter, das Subjekt, das Programm, die Ideale des Kommunismus und des Anarchismus als Horizonte, die es in einer nicht genau festgelegten Zukunft zu verwirklichen gilt, gehören einer Epoche an, die, wenn es sie je gegeben hat, wenig mit der heutigen zu tun hat, wie selbst Mario Tronti am Ende einräumt.5
Zu diesen Überlegungen können wir den fruchtbaren Ansatz hinzufügen, einige der jüngsten Bewegungen als „Memes ohne Ende“ zu betrachten, als Aktionsformen, die sich eher durch „mimetische und memetische“ Resonanz als durch das Festhalten an Programmen und Diskursen ausbreiten. Diskurse, die unter dem Druck der „Riots ohne Begründung”, die die Aktionen der zeitgenössischen Aufstände charakterisieren, zusammenbrechen.6
Der Versuch, Bewegungen in ein Interpretationsraster einzupassen, das ihre soziologischen Erscheinungen und Identitäten erklärt, ist kein einfaches deskriptives Unterfangen, ebenso wenig wie sich die Behauptung, dass die Identitäten und Diskurse der Aufständischen verschwimmen, auf eine einfache sozialwissenschaftliche Beobachtung reduzieren lässt. Die Kategorie der Non-Bewegung soll deskriptiv sein, um – vielleicht nostalgisch – den „Niedergang der Politik“ in den zeitgenössischen Formen der Mobilisierung festzustellen. Das Problem liegt jedoch auf einer komplexeren Ebene, denn es ist, wie bereits erwähnt, von zentraler Bedeutung, eine Perspektive auf und in den Phänomenen zu entwickeln, die von „Autonomie im/des Konflikts“ geprägt ist und nicht an deterministische Züge einer soziologischen Matrix oder an reformistische Züge der Beanspruchung und Neugestaltung der verschiedenen Arten von Governance gebunden ist.
Deshalb kann man sagen, dass die scheinbar harmlose und neutrale Kategorie der „sozialen Bewegung“ in Wirklichkeit auch ein Instrument bezeichnet. Es handelt sich um ein Instrument, das immer in Aktion ist und den Konflikt auf eine Konsolidierung der sozialen Identitäten und eine Dialektik gegenüber dem Staat oder irgendeiner Form von Institution ausrichtet: Es nährt das öffentliche Gesicht eines Kampfes zum Nachteil des klandestinen, es wirkt auf eine Weise, dass der Konflikt in der öffentlichen Sphäre mit ihren Ritualen und ihren diskursiven und legitimatorischen Regimen so deutlich wie möglich kodifiziert wird.
Auch wenn dieser Mechanismus in vielen Momenten durch die affektive und ethische Intensität der Formen der Revolte außer Kraft gesetzt wurde, kann man nicht davon ausgehen, dass diese Form der politischen Kodifizierung vollständig verschwunden ist und den Non-Bewegungen Platz gemacht hat. Im Gegenteil, sie war in jenen paradigmatischen Non-Bewegungen wie den Gelbwesten oder so vielen anderen Kämpfen am Werk und hat sie in jene ohnmächtigen Formen zurückgeführt, die wir vereinfacht gesagt als strategischen Horizont eines Kampfes gegen die Instanz und eine bloße „demokratische“ Umgestaltung der Herrschaft bezeichnen könnten, in Formen des Kampfes, die in endlosen Versammlungen zentralisiert sind, in die Abwertung individueller Erfahrungen, in den Tod jedes kreativen Antriebs, der einen Raum für Ritualismus und Zwang zur Wiederholung zurücklässt.
Wie kann man dann die Kraft benennen, die in der Lage ist, diesen Mechanismus zu deaktivieren, der den unbeherrschbaren und anomischen Charakter jedes Konflikts und Antagonismus zähmen will?
In dieser Lücke, die sich ohne Worte ausdrückt, in dieser explosiven karstigen Kraft, liegt die Möglichkeit, eine revolutionäre Perspektive zu erahnen und auszuleben.7 Die revolutionären Gründe für einen Kampf sind genau jene, die keinen Platz in einem bereits gegebenen Rechtfertigungsraster finden. Es geht darum, diese dem Wort entzogenen Gründe zu erforschen, um sie zu verstärken, nicht um sie zu übersetzen und anderen hinzuzufügen (im Gegensatz zu denen, die an eine demiurgische Macht des Wortes glauben, und die in der Lage sind, „Konvergenzen“ [der Kämpfe oder Bewegungen, Anm. d. Ü.] auszuhecken, indem sie Reden verbreiten, die nur dazu gut sind, einige nostalgische Linke zu beruhigen, wie das Beispiel von GKN lehrt).
Eine ziemlich stichhaltige Hypothese ist die der „destituierenden Macht” [siehe Fußnote 3] die bereits vom Collectivo Situaciones in Bezug auf die “Piqueteros” ‚ in Argentinien im Jahr 2001 untersucht wurde, die sie als “destituierenden Aufstand” bezeichneten. Ich halte es jedoch für wichtig zu betonen, dass es nicht einfach darum geht, eine neue beschreibende Kategorie, ein neues Etikett für eine akademische Forschung, die sich durch Originalität auszeichnen will, zu entwickeln, sondern eine Kategorie, die die Ausarbeitung einer erkenntnistheoretischen Positionierung ermöglicht, die auch „strategisch“ ist.
Wie ein Genosse auf einen Negrianer antwortete, der von konstituierender Macht und Gelbwesten, konstituierenden Versammlungen und neuen Verfassungen faselte: „Ein Ziel zu definieren, ist vor allem eine Methode“, und daher gibt es „in jeder Bewegung eine destituierende und eine konstituierende Seite“ – das Problem sind diejenigen, die sich eine Vorstellung von der Revolution zu machen, die aus neuen Verfassungen besteht, die in die Käfige des Gesetzes eingefügt werden. Es gibt keine konstituierende-destituierende Dichotomie, die es zu überwinden gilt, es gibt die wechselseitige Beziehung zwischen konstituierend und konstituiert, an der alle Revolutionen gescheitert sind; und denjenigen, die glauben, dass die Destitution einfach diese Lobpreisung des Negativen und der Zerstörung ist, antworten diese Worte wortgewandt: „Nur vom destituierenden Standpunkt aus können wir all das begreifen, was in der Zerstörung unglaublich konstruktiv ist“ und wiederum: „Die destituierende Geste ist also Desertion und Angriff, Ausarbeitung und Zerstörung, in derselben Geste.“
Aber vielleicht ist es sinnlos, Zeit mit ethischen Analphabeten zu verschwenden, die keine Möglichkeit eines erfolgreichen Aufstandes oder Kampfes sehen, außer in den sterilen Maschen des Rechts, der Governance oder der Biopolitik.
Das Interessante und noch zu erforschende an der Hypothese der Destitution liegt in der Möglichkeit, die Revolution anders zu denken und dieses Problem in den Mittelpunkt der modernen Politik zu stellen.
Während Bayat argumentierte, dass Non-Bewegungen „Revolutionen ohne Revolutionäre“ produzieren (die herrschende Klasse also in der Lage ist, die Auswirkungen des Aufstands in Richtung einer neuen souveränen Ordnung in den arabischen Ländern zu leiten), so ist Endnotes der Meinung, dass sie „Revolutionäre ohne Revolutionen“ produzieren; mit der Hypothese der Destitution ist es möglich, Revolution anders zu denken und, auch wenn wir das Gefühl teilen, in konterrevolutionären Zeiten zu leben, die Suche nach revolutionären Überlegungen voranzutreiben, ohne auf eine neue Phase zu warten.
Was mir interessant erscheint, ist, dass „destituierende Aufstände“ wie die Gelbwesten uns empirische Hinweise liefern: das heißt, die Möglichkeit, grundlegende theoretische Fragen in gelebten Erfahrungen und Ereignissen zu verankern.
Insbesondere das diskursive Chaos, das Forderungen und Meta-Forderungen vervielfachte, die disruptive Kraft in Verbindung mit der Verweigerung, sich repräsentieren zu lassen, aber vor allem, im positiven Sinne, die Fähigkeit, Lebensräume außerhalb jedes demokratischen öffentlichen Raums zu entwickeln und auf ein unmittelbares Bedürfnis nach Gemeinschaft zu reagieren, verdienen es, weiter untersucht zu werden. Es ist notwendig, einen Forschungs-, Untersuchungs- und Handlungsansatz zu definieren, der nicht abstrakt ist, sondern in Kontakt mit weiteren Erfahrungen steht.
Einschub
Das Problem wird dadurch verkompliziert, dass es nicht nur darum geht, darüber nachzudenken, wie man sich in den Mobilisierungen und Aufständen verortet, die punktuell im zeitgenössischen öffentlichen Raum auftauchen. Vielmehr geht es ganz allgemein darum, wie man sich selbst verorten kann, auch wenn es keine intensiven Mobilisierungen gibt, oder nach welchen Kriterien man die verschiedenen Mobilisierungen unterscheiden kann, wenn man sich von denen der Ideologie und der sozialen Identitäten löst.
In Italien erleben wir seit langem eine Phase der Reaktion und Konterrevolution. Das Fehlen massiver Mobilisierungen, wie sie in anderen Teilen der Welt zu beobachten sind, ist ganz offensichtlich, was dazu führt, dass sich ein stabiles Szenario skizzieren lässt, in dem die so genannte „Bewegung“ „unbeweglich“ ist. Politische Identitäten überleben und reproduzieren sich selbst und behindern das Entstehen neuer Organisationsformen. Der „Racket“ der Bewegungspolitik scheint keine Anzeichen zu zeigen, dass er nachlässt, und kämpft mit einem Überleben, das reiner Taktik entspricht.
„Je mehr sich die spontane Intelligenz der Ablehnung jeder Bedingung, die den Tod ins Leben gebracht hat, den Erfordernissen des Überlebens, ja des Überlebens im Kampf, beugt, desto mehr verwandelt sie sich in spontane Intelligenz des Feindes. Die Taktik ist immer das ‚vernünftige‘ Gesicht der Konterrevolution.”8
Nichtsdestotrotz haben wir in letzter Zeit plötzliche Anzeichen einer Revolte erlebt:
Im Jahr 2020 gegen die aus absurden hygienischen Gründen verhängte Ausgangssperre; sowie einige schwache Zeichen des Protests gegen den Impfstoff und den Impfpass; während wir heute Zeugen einer Reihe von hyperlokalen (manche würden sagen: „interstitiellen”9 Mikrokonflikten gegen ‘grüne“ oder „sozial integrative“ territoriale Transformationen sind, die durch Konjunkturprogramme und europäische Staatsschulden gedopt werden.
Dies sind schwache Momente, in denen man sich oft fragt, ob es sinnvoll ist, Energien zu investieren und sich in diesen Mobilisierungen Risiken auszusetzen. Doch bevor wir uns mit dieser Art von Mikrokonflikten befassen, lohnt es sich, die Kriterien, die uns dazu veranlassen, sie mit besonderem Interesse zu betrachten, näher zu bestimmen.
Die Grammatik der zeitgenössischen Macht: pandemische Governance, algorithmische Gouvernementalität und grüne Biopolitik.
Covid macht deutlich, dass wir Zeugen einer Regierungsgewalt sind, die sich nicht nur mit Infrastrukturen ausstattet, die die Entwicklung materieller Autonomie verhindern, sondern auch über eine Reihe immaterieller Infrastrukturen verfügt, die den Sinn und die Bedeutung von Handlungen definieren und moralische Anordnungen verbreiten. Es handelt sich dabei um erkenntnistheoretische Infrastrukturen, die definieren, was wahr sein kann, was legitim ausgedrückt werden kann und wie Wahrheit konstruiert werden kann.
Die große Abhängigkeit von diesen Infrastrukturen, selbst in so genannten „antagonistischen“ oder „autonomen“ Kreisen, zeigte sich deutlich während der „Pandemiekrise“, in der die Anpassung an den vorherrschenden öffentlichen Diskurs sehr schnell erfolgte: Die Suche nach Legitimität anhand von Kriterien, die sich Leerformeln wie „Care“ und „Gemeinwohl“ unterordnen, war ganz offensichtlich.
Das Problem, das sich stellt, besteht nicht einfach darin, die Aussagen dieser oder jener (wissenschaftlichen oder politischen) Institution zu kritisieren. Es geht darum, die Widersprüche oder die wissenschaftliche Fundiertheit in einem Mechanismus der Widerspruchslosigkeit zu erkennen, der sich auf einer diskursiven Ebene entwickelt, die auch die gleiche erkenntnistheoretische Ebene ist, auf der die Anordnungen der Macht ausgearbeitet werden.
Das Problem besteht darin, den operativen Indikator zu verstehen, der den Prozessen der Wirklichkeitskonstruktion durch deskriptive Modelle, die auch präskriptiv sind, zugrunde liegt.
Um ein Beispiel zu nennen: Es geht nicht darum, das Management der Pandemie zu kritisieren, indem man die Konstruktion der statistischen Daten, die nicht hinreichend genau sind, kritisiert, indem man andere statistische Daten oder andere beschreibende Modelle einer mathematischen Matrix vorlegt. Es geht nicht einmal darum, die Art und Weise zu kritisieren, in der die Daten erhoben wurden (die, obwohl das Wort suggeriert, dass es sich um „Daten“ handelt, in Wirklichkeit nur „Konstrukte“ sind). Sondern darum, zu verstehen, welche biopolitischen Prinzipien implizit wirkten, welche Lebensformen durch eine ebenso materielle wie immaterielle Steuerung hergestellt werden sollten.
Die Art und Weise, wie diese „Wahrheiten“ in den öffentlichen Raum hineingetragen wurden und wie völlig vergeblich versucht wurde, sie in genau diesem Raum dialektisch zu kritisieren, machte eine Krise oder Nichtexistenz dieses mythologischen Raums deutlich, in dem gegensätzliche Interessen durch Synthesen gelöst werden sollten. Was als „öffentlicher Raum“ bezeichnet wird (der im Paradigma der demokratischen Polis der Ort sein sollte, an dem verschiedene „Wahrheiten“ gemessen und verglichen werden), ist in Wirklichkeit frei von jeglicher Dialektik und Pluralität, in ihm kann keine soziale Ordnung umgestoßen werden.
Vor allem heute ist die öffentliche Sphäre weitgehend in die algorithmischen Architekturen des digitalen Kontinents überführt worden, die jede Form des Unwohlseins innerhalb und außerhalb ihrer Räume neutralisiert und visualisiert; die öffentliche Sphäre wird von einem vermeintlichen Ort der Konfrontation und Synthese divergierender Interessen oder einem Ort, an dem sich ein „Gemeinwohl“ durchsetzen kann, eindeutig zu einem Ort der Visualisierung. Für Militante und Aktivisten scheint dies kein Problem zu begründen, da sie sich zu sehr auf Formen der Selbstverherrlichung konzentrieren, die sie in diese Blasen einschließen, die nichts anderes sind als marginale Ecken dieser öffentlichen Sphäre, in denen sie unschädlich gemacht werden. Manchmal gelingt es ihnen durch ausgeklügelte Kommunikationsstrategien große Sichtbarkeit zu erlangen und in diesem öffentlichen medial-algorithmischen Raum aufzutauchen, der nach Legitimationslogiken strukturiert ist, die nichts anderes sind als die Diskurse der Regierung: Biopolitik in Gesundheitssoße oder Biopolitik in Ökologensoße, zwei Seiten derselben Medaille, die die Formen der zeitgenössischen Herrschaft kennzeichnen.
Diese Architekturen der Macht, die einige als algorithmische Gouvernementalität bezeichnet haben, wirken operativ auf die Realität ein, indem sie sie auf scheinbar „unpersönliche“ Weise erschaffen und sie hinter einem dichten Gewebe technischer Apparate verstecken.10
Angesichts einer solchen Realität gibt es kein Agon, kein Meson der Polis, sondern lediglich einen Raum, in den die Rationalitäten/Irrationalitäten der Regierung hineingegossen und aufgezwungen werden, in dem alle Erfahrung neutralisiert und auf Bildschirme gepresst wird. Auch wenn es schon lange keinen Grund mehr gab, an die dialektischen Formen unten-oben, soziale Bewegung-Institution zu glauben; angesichts dessen, was geschieht, inmitten von Prophezeiungen, die zwischen einem klimatischen und einem medizinischen Katastrophismus oszilieren, ist eine solche Naivität nicht mehr akzeptabel.
Konspiration und Abtrünnigkeit
Was wir während der Covid-Periode erlebt haben, war – mit Hilfe des Etiketts der „Verschwörungstheorie“ – eine starke Verdrängung einer ganzen Reihe von Empfindungen und Diskursen aus der so genannten „öffentlichen Sphäre“, die die Wissenschaft als Religion ablehnten.
Es war eine Phase, in der etwas, was schon seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit zu beobachten war, plötzlich Wirklichkeit wurde: Eine Form von radikalem Skeptizismus durchdringt die Menschen, die die demokratischen Fiktionen des Westens leben; es ist, als ob die viel zitierte „Krise der Repräsentation“ nichts anderes als ein Symptom einer tieferen Ablehnung der Manipulationen der Fernsehinstitutionen ist.
Verschwörungstheorien“ und ‚Fake News‘ sind zum neuen Hauptfeind der Demokratie geworden, weshalb sie vielleicht eine tiefere Beschäftigung verdienen, vor allem dann, wenn sich selbst Regierungserklärungen durch an das Religiöse grenzende Diskurse und Rituale zu rechtfertigen scheinen.11
In Telegram-Chats und Facebook-Gruppen vervielfältigten sich die verschiedenen Diskurse auf chaotische Weise, bis hin zu den Theorien, die in den Medien große Aufmerksamkeit erlangten, wie QAnon. Oftmals erkannten einige dieser Theorien einerseits agencies an, die spezielle Interessen verfolgten, sogar zum Nachteil der gesamten Menschheit, versuchten aber gleichzeitig, einige ihrer Ablehnungen zu rechtfertigen, indem sie sich zweideutig auf dieselbe technische und epistemologische Ebene wie die Regierung begaben und vielleicht diese oder jene Aussage in Frage stellten… man könnte die Hypothese aufstellen, dass es in der Gesundheitsfrage eine Bewegung der Ablehnung gab, die es nicht schaffte, eine völlige Autonomie von einer Diskursebene und einem Wahrheitsregime auszubilden und zurückfiel auf eine Reihe von technisch-wissenschaftlichen Formulierungen. Mit Ausnahme von Theorien wie QAnon und dergleichen, die jedoch anders zu verstehen sind: Wie ein vermeintlicher Anhänger, der in einem BBC-Podcast interviewt wurde, auf die Frage, ob er wirklich glaube, dass der Papst Blut von Föten trinke, antwortete: „Verschwörungstheorien sind nicht wörtlich zu nehmen, es ist ein bisschen wie mit der Bibel, sie bedürfen der Interpretation“ … vielleicht sollte man die Worte derjenigen, die während der Pandemie die absurdesten Theorien geäußert haben, auf die gleiche Weise verstehen. Ohne in den Soziologismus zu verfallen, aber auch ohne in die verschiedenen Formeln des ‚ok, aber…‘ eines Teils der Linken zu verfallen, der auf jeden Fall eine zweideutige Position der ‚Toleranz‘, aber auch der ‚Distanzierung‘ gegenüber den ‚Verschwörungstheoretikern‘ eingenommen hat. Vielleicht weil sie zu besorgt darüber waren, ihre soziale Glaubwürdigkeit zu verlieren.
In jedem Fall haben diese Diskurse mit den Mobilisierungen gegen den Impfausweis einen neuen Aufschwung genommen und dazu geführt, dass viele der Blasen und getrennten Räume in den Architekturen des digitalen Kontinents aufgebrochen wurden, was zu Konfrontation und Austausch geführt hat.
Der Bewegung gegen den Green Pass12 ging ein konfliktreicher Moment von gewisser Intensität voraus, der in Turin (und anderen Städten) den Anschein einer Revolte mit Plünderungen in den Einkaufs- und Tourismusstraßen erweckte: ein Abend, der zudem durch den ungewöhnlichen Protagonismus junger Menschen gekennzeichnet war…13 Nichts dergleichen hat sich je wiederholen lassen, obwohl viele damit gerechnet hatten, dass sich auch in Italien endlich eine unreine Revolte entwickeln würde.
Vielleicht führte ein von den Szenen der Revolte der Gelbwesten verwöhnter Blick sowie eine Art Riot-Fetischismus zu geringem Interesse an der Mobilisierung, die sich im folgenden Sommer gegen die Impfpflicht richtete. Trotz eines anfänglichen Moments großer Beteiligung, in dem eine Spannung spürbar war, die zu intensiveren Gesten als bloßen Protestzügen führen konnte, verlief die Mobilisierung schnell in den ohnmächtigen Formen des Protests und wurde von konkurrierenden Anführern monopolisiert: die übliche Racketisierung der Politik.
Aus dieser Mobilisierung lässt sich jedoch eine zentrale Frage ableiten:
Wenn man der Meinung ist, dass sich um diese Beziehung zwischen Wissenschaft und Regierung etwas Wichtiges abspielt, wie es durch die Pandemie, die neuen grünen Akkumulationsregime, die Ökologismen und die künstliche Intelligenz signalisiert wird, ist es dann möglich, eine Intervention, eine Beteiligung an diesen Formen der Mobilisierung zu entwickeln, die sich um eine Ablehnung dieser Regierungsformen bewegt? In welche Richtung?
Oft fällt man unbewusst auf die Suche nach einem unmittelbaren Ergebnis zurück: Effektivität der Handlung, Intensität der Handlung oder Erreichen einer gewissen Medienaufmerksamkeit.
Bei unseren Überlegungen über eine Intervention glaube ich, dass wir einerseits die Grenzen des „Wortes“ und des Diskurses anerkennen müssen, wenn er nicht zur Handlung anleitet; wenn wir die Scheidung zwischen programmatischer Sprache und Handlung als offensichtlich betrachten, … ist es klar, dass sich eine diskursive Intervention (die die richtigen Forderungen aufstellt) innerhalb der zeitgenössischen diffusen Mobilisierungen als Fehlschlag und einschränkender Faktor erweisen kann.
Wie kann andererseits die Intensität der Handlung erhöht werden? Vielleicht indem man verhindert, dass sie schnell in den Ritualen der sozialen Bewegung aufgeht: Demos, Korsos und verschiedene „Paraden“. Es geht also darum, wie bereits jemand vorgeschlagen hat, nicht nach radikalen Akteuren oder Reden zu suchen, sondern nach radikalen Gesten, die eingeführt oder aufgespürt und verstärkt werden müssen.14
Hierin liegt die Notwendigkeit, eine organisatorische Dimension zu entwickeln, die darauf abzielt, eine Reihe von rekursiven Mechanismen zu deaktivieren und unwirksam zu machen, die sich etabliert haben und die dazu führen, dass ein Konflikt die Form einer sozialen Bewegung annimmt.
Der Versuch, gegen alle vorzugehen, die ihre Formen klären und ihre Praktiken institutionalisieren wollen: die den Tod jeglicher taktischer Kreativität bestimmen, indem sie diese in ein Regime von Praktiken und ein Legitimationen einbinden, die auf dem sozialen und demokratischen Apparat und auf der Zentralität des leeren Raums namens „Öffentlichkeit“ basieren. Diejenigen, die sich in Richtung eines solchen Versuchs bewegen, können wir als „Agenten der Separation“ bezeichnen, da sie durch ihre aktive Beteiligung politische Formen in Richtung einer Trennung von der klassischen Politik drängen.
Einige Untersuchungshypothesen: lokale Kämpfe gegen grüne oder „sozial integrative“ Transformationen.
Das bedeutet, dass die Rolle der „Revolutionäre“ oder der „Organisation“, wie sie normalerweise verstanden wird, in dieser Perspektive radikal revidiert werden muss. Wenn, wie bereits erwähnt, Aktivisten und Militante (die „Bewegung“) oft eine offensichtliche Komplizenschaft mit den (wissenschaftlich gefärbten) Formen der biopolitischen Herrschaft gezeigt haben, indem sie sich die verschiedenen Klima- oder Gesundheitsnotstände zu eigen machten, ist es notwendig, sich von der „Bewegung“ zu separieren.
Daraus ergibt sich die Dringlichkeit, eine neue Komplizenschaft außerhalb dieser Kräfte zu finden, und zwar vor allem durch die Schärfung einer strategischen Positionierung.
Aber wie können neue Komplizenschaften erreicht und geschaffen werden? Wie lassen sich die neuen Formen der Desertion aufspüren? Wie kann man ihr Potential einschätzen? Wie kann man aus der Abhängigkeit des Blicks, d.h. der Beobachterrolle, die uns von den Phänomenen trennt, herauskommen und stattdessen eine Form des Kontakts entwickeln, die sich von den Grenzen der aus der Vergangenheit übernommenen deformierenden Linsen zu befreien vermag?
Es gibt spektakelhafte und harmlose Formen der Desertion, die im linken Diskurs sehr beliebt sind: die Rückkehr in die Berge, Neo-Ländlichkeit, Öko-Dörfer, alles Träume vom sozialen Frieden, die uns nicht interessieren.15 Es ist klar, dass diejenigen, die desertieren, und zwar auf eine andere, Schaden verursachende Art und Weise, dies sehr oft unsichtbar tun, aber wie kann man eine solche Desertionsbewegung aufspüren?
Andererseits ist es sicherlich nichts Neues, dass viele Formen des Widerstands flüchtige und unsichtbare Wege gehen. Sie versuchen, sich den Blicken der Herrschenden zu entziehen, um an Offensivität und Handlungsfähigkeit [potenza] zu gewinnen. Nur einige wenige Social-Network-Junkies oder Mythomanen mögen denken, dass Konflikte nur das sind, was man in den Zeitungen oder in den sozialen Netzwerken sieht, oder dass sie mit großen Proklamationen angekündigt werden sollten.
Vielleicht besteht eine Hypothese darin, von einer Form der erfahrungsmäßigen und territorialen Nähe auszugehen, um auf neue Formen der Desertion zu stoßen: wieder bei den Formen des Konflikts anzufangen, auch auf die Gefahr hin, auf die halböffentlichen zurückzufallen, die aus dem Blickfeld geraten, und zu versuchen, hinter ihrer Fassade zu graben.
Ohne den Ehrgeiz, riesige Mobilisierungen aufzubauen, sondern in dem Glauben, dass es in kleinen nachbarschaftlichen Widerständen möglich ist, mit Vorgehensweisen zu experimentieren und Hypothesen zu bewerten. Vor allem kann man versuchen, Formen gemeinsamer Erfahrungen mit denjenigen zu erforschen, die eine Ablehnung auferlegter Wahrheitsregime teilen und sensible Wahrheiten bekräftigen, die viel tiefer liegen als die der entfremdeten Techniker.
Mikroterritoriale und interstitielle Widerstände.
In den letzten anderthalb Jahren haben der nationale Konjunktur- und Resilienzplan und andere Finanzierungsformen die ganze Gewalt der neuen städtischen Akkumulationsregime zum Vorschein gebracht, die eine Inwertsetzung des Grünen und der „städtischen Natur“ anstreben (sei es im Sinne von Ökosystem-Dienstleistungen und damit einer ökologischen Quantifizierung, sei es im Sinne von tatsächlichen spekulativen Projekten). Dies hat einige hyperlokale Konflikt- und Widerstandsfronten eröffnet und damit auch die Möglichkeit, die Beziehung zu bestimmten Territorien zu entwickeln und zu vertiefen, das heißt, neue ethisch-territoriale Dichten zu schaffen.
Diese städtischen Umgestaltungsprojekte sind oft auch auf wissenschaftlicher und technischer Ebene umstritten und werden daher hinsichtlich ihrer tatsächlichen „ökologischen Nachhaltigkeit“ kritisiert. Interessant ist jedoch, dass nach dem Covid eine Art Ablehnung des technischen und wissenschaftlichen Diskurses, in den das Regierungshandeln gekleidet ist, zurückkehrt, nicht um eine andere Form von wissenschaftlicher Wahrheit voranzutreiben, sondern eine fragmentarische Reihe von sehr persönlichen Motiven, die schwer zu synthetisieren sind: Darunter gibt es natürlich auch Versuche, technische Gründe vorzubringen, aber diese sind nicht diejenigen, die es schaffen, diejenigen zu vereinen, die sich gegen diese Projekte auflehnen.
Um einige Erfahrungen in verschiedenen Städten, aber mit ähnlichem Charakter zu nennen, könnte man auf die Fälle des Don-Bosco-Parks in Bologna,16 die Verteidigung des Parks Madonna di Campagna in Busto Arsizio, den Agro di Selargius in Südsardinien oder zwei Kämpfe in Turin zur Verteidigung einer Allee und eines Parks verweisen.
Man könnte sicherlich in die Schuhe eines Soziologen schlüpfen, um eine Skizze der beteiligten sozialen Figuren zu erstellen, aber es würde wenig nützen, um zu erklären und zu verstehen, warum Menschen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund beschlossen haben, ihre eigene Unversehrtheit zu riskieren, um zu verhindern, dass Bauarbeiter ihr Territorium zerstören. Die Verbundenheit mit einem Ort ist etwas Ethisches und Affektives, nicht so sehr etwas Ideologisches oder Wissenschaftliches. Wenn man ein Gebiet bewohnt, entwickelt man nonverbale affektive Bindungen, die diesen Ort zu einem Teil von einem selbst machen, und man fühlt sich diesem Ort zugehörig. Das macht es schwierig, diese Art von Bindungen zu entfremden oder in ein Ensemble von Vermittlungsprozessen zu übertragen. Beim Kampf um einen Ort oder ein Territorium kommt eine unbeugsame Komponente ins Spiel, die nicht für etwas Abstraktes kämpft, sondern das Ergebnis einer spezifischen materiellen Bindung ist, die, je intensiver sie ist, umso mehr Feindschaft gegen die Kräfte entwickelt, die sie zerstören wollen. Es geht nicht um abstrakte Umwelt- oder ökologische Probleme, sondern um das Zusammensein an einem spezifischen Ort.
Jemand hat den Begriff der „Komposition“17 für diese Art von Kampf entwickelt, aber wie bereits geschrieben wurde, kann dies eine organisatorische Methode sein, die eher taktisch als strategisch ist und von einem destituierenden Pfad begleitet werden muss, um die klassischen Sackgassen der territorialen Kämpfe zu überwinden.18 In diesem Sinne ist es über die Zusammensetzung hinaus notwendig, den Konflikt innerhalb jedes Konflikts zu identifizieren. Dabei handelt es sich nicht um einen leibhaftigen Feind, sondern um eine Art und Weise des Handelns, Denkens und Kommunizierens, die auf die Herausarbeitung der Gründe für den Kampf und seine Legitimierung auch auf administrativer Ebene abzielt und somit ein besseres Bild in der Öffentlichkeit anstrebt. Diese Bestrebungen führen häufig zu einer Zentralisierung der Organisationsform um Führungspersönlichkeiten herum, aber auch zu äußerst bürokratischen Instrumenten wie der Versammlung.
Im Fall des Corso Belgio verhinderte eine heterogene Gruppe von Menschen, dass die Fahrzeuge der Bauarbeiter zu den zu fällenden Bäumen gelangten, und besetzte dann dauerhaft die Allee und verwandelte Parkplätze in einen Ort des Lebens. Gleichzeitig fand ein anderer Vorstoß statt, der das öffentliche Gesicht der Gruppe in den Vordergrund stellte und die absolute Güte und Legitimität ihrer Aktionen betonte. Zu diesem Zweck wurden bestimmte Diskurse als von Verschwörungsideologie geprägt gebrandmarkt, während stattdessen eine Reihe von technischen Rechtfertigungen als Quantifizierung des Nutzens dieser Bäume durch die schändliche Kategorie der „ Ökosystem-Dienstleistungen “ ausgearbeitet wurde. Das Ergebnis war, dass die Kraft dieser Erfahrung nachließ und in der Zwischenzeit der „legale Weg“ gestärkt wurde, während sich eine interne Bürokratisierung und Hierarchisierung allmählich durchsetzte: Diejenigen, die über ein paar mehr verbale Ausdrucksmittel verfügten, konnten sich an die Spitze der Mobilisierung setzen.
Es gibt ein besonders bedeutsames Zitat von Mascolo, das in den diesem Autor gewidmeten Notizen19 zitiert und in einem neueren Text aufgegriffen wird.20
“Jeder von uns hat das große Schauspiel des Dialogs zwischen einem einfachen Menschen und einem Experten der klaren Sprache schon tausendmal persönlich miterlebt. Der Mann der klaren Sprache spricht, bringt Gründe vor, stützt sich auf unzählige Argumente: er allein hat das Arsenal der Argumente. Er ist also im Vorteil. Er ist unwiderlegbar. Er hat das letzte Wort. Der andere, der keine klare Sprache hat, weil seine Situation, die er nicht idealisiert hat, nicht klar ist, kann am Ende nur schweigen und scheint sein Unrecht zuzugeben. Im nächsten Moment finden wir ihn gedemütigt, aber überzeugt, dass er im Recht ist, ohne einen klaren Grund. Es scheint ihm dann, dass Gewalt allein vielleicht das Richtige gegenüber der klaren Sprache ist, die ihm Unrecht tut. Und er hat Recht. Klare Sprache ist Vereinfachung. Es ist die idealistische Vereinfachung. Um der Unklarheit der Revolution gerecht zu werden, muss man erst auf die rationale Illusion der klaren Sprache verzichtet haben.“21
Die revolutionären Gründe für einen Kampf sind genau jene, die keinen Platz in einem bereits vorgegebenen Rechtfertigungsraster finden. Wir untersuchen diese Gründe, bar jeglicher Worte, um sie zu intensivieren, nicht um sie zu übersetzen und anderen hinzuzufügen.
In vielen dieser territorialen Kämpfe hat es eine vergleichbare Separation gegeben, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Trennung zwischen diesen beiden Seiten nicht eindeutig ist und nicht starr durch bestimmte Identitäten verkörpert wird. Die beiden Fronten können beweglich sein, der Einzelne kann ständig von der einen auf die andere Seite wechseln (der Bürger kann seine alten Überzeugungen schwankend aufgeben und wieder aufnehmen), es geht darum, die richtige Positionierung zu finden, diejenige, die die Latte der Feindschaft gegen die Institutionen und ihre Projekte jedes Mal höher legt, nicht nur mit Worten, sondern mit Gesten.
Wir können also von einer Form sprechen, die man als „Komitee-Form“ bezeichnen könnte, die ein Problem und eine Grenze für das Gedeihen dieser Art von Kampf darstellt. Das Problem ist nicht „formal“, d.h. die Existenz oder Nichtexistenz eines strukturierten Komitees, sondern die Art und Weise, wie man dazu neigt, eine Gemeinschaft im Kampf zu bilden. Und diese Art von Reflex berührt nicht notwendigerweise nur die Bürger, die überall offizielle Komitees gründen wollen, sondern auch die militanten Gruppen, die spiegelbildlich ihre eigenen Formen der Identifikation in den Mittelpunkt stellen können (und so den Kampf als Raum für den Ausdruck ihrer Identität durch Slogans, Verhaltensweisen und spezifische Aktionen nutzen).
Oft versucht diese Form, sich mit überlokalen Plänen auszustatten, um sich besser legitimiert zu fühlen und um auf der gleichen Ebene wie die regional-lokalen Regierungen einen Dialog führen zu können. Es erübrigt sich zu sagen, dass sich diese Arten von politischen Verpackungen und Etiketten zumeist als leer und unwirksam erweisen und nur dazu dienen, ein Treffen und einen Austausch zwischen einigermaßen ähnlichen Erfahrungen zu ermöglichen.
Das Bestreben, das hinter den hier präsentierten Überlegungen und Versuchen steckt, ist es, diese “Komitee-Form” zu dezentralisieren, sie durch eine Reihe von Arrangements aufzulösen, durch Wege, in die Energien investiert werden können:
-
Die Präsenz vor Ort und den informellen Austausch zwischen den Beteiligten favorisieren.
- Die Formalisierung und Verfestigung einer Versammlungsform verhindern, ihre Festlegung als grundlegendes Entscheidungsmoment unterbinden, das andere Formen der Initiative behindern und die Entwicklung eines Kampfes bürokratisieren würde.
-
Gleichzeitig sollten endlose Versammlungen mit ihrer vorgetäuschten Horizontalität vermieden werden, und es sollte vermieden werden, Raum für diese Formen des performativen Protagonismus zu lassen.
-
Raum lassen für alle Arten von Diskursen und Motiven, ohne dass ein Plan irgendeine Form von Zentralität annimmt.
-
Deutlich machen, dass Formen der Vermittlung meist eine Farce sind und dass ein NEIN zur gleichen Zeit absolut und affirmativ sein kann.
-
Vermeiden, sich auf dieselbe epistemologisch-planerische Ebene zu begeben wie die Regierung des Territoriums und der anderen Seite Planungsalternativen vorzulegen, die sich nur von diesen Alternativen ernähren und sie auf eine mystifizierende Weise integrieren würde. Es ist nicht notwendig, eine Alternative zu haben, um NEIN zu sagen.
- Vermeiden, diese Kämpfe als umweltpolitische Kämpfe zu kodifizieren oder mit einem Etikett zu versehen, das die gegenwärtige öffentliche politische Debatte kennzeichnet. Vielmehr sollte bekräftigt werden, dass die Handlungskraft [potenza] und die Möglichkeit des Sieges eines Kampfes in der Präsenz, im Leben und Bewohnen eines Ortes liegt. Aus diesem Grund ist es, auch wenn man (globale, europäische, nationale oder bürgernahe) Prozesse identifizieren kann, die diese Gebiete in irgendeiner Weise bedrohen, strategischer, die Einzigartigkeit des Kampfes selbst zu betonen, um ihn zu intensivieren, als eine Ausweitung auf Themen vorzunehmen, die je allgemeiner desto weniger offensichtlich sind:
Um die eindrucksvolle Formel eines Freundes aufzugreifen, geht es nicht darum, sich in einen ökologischen Diskurs zu kleiden, sondern die Erfahrung einer „Ökologie der Präsenz“ zu machen.22
Offensichtlich ist das, was bis hierhin entwickelt wurde, weitgehend unzureichend. Es gibt zahlreiche weitere Grenzen und Schwierigkeiten, auf die man stoßen kann.
Wie kann man zum Beispiel einen solchen Ansatz durchsetzen, ohne in eine Form der hegemonialen Auseinandersetzung und eine Logik der Konkurrenz zu verfallen, wenn man bei dieser Art der Mobilisierung mit anderen Gruppen, die die „Bewegung“ bilden, mit ihren Reflexen und Ritualen in Berührung kommt?
Wenn man nicht den Ehrgeiz kultiviert, die Partei zu sein, die den Aufstand organisiert, insbesondere angesichts der reduzierten Dimension dieser Art von Konflikten, welche Art von „Sieg“ kann man dann vorhersehen? Sicherlich können solche Erfahrungen in Ermangelung von Momenten der Massenmobilisierung dazu beitragen, Beziehungen zu vertiefen, aber auch stärkere Kampfinfrastrukturen zu entwickeln, mit ihnen zu experimentieren, die eigenen Organisationskapazitäten zu verbessern und größere autonome Kapazitäten aufzubauen.
Auf einer allgemeineren Ebene zeigten Erfahrungen wie die in Turin und Bologna jene Probleme der Mehrdeutigkeit auf, die auch in einem Teil der Bewegung gegen den Green Pass zu finden waren: die Tendenz, auf den erkenntnistheoretischen Diskurs der Regierung zurückzugreifen, um den Widerstand zu legitimieren, und dass diese Ebene vorherrschend wird.
Es bleibt noch zu untersuchen, wie man sich durch diese Mehrdeutigkeiten hindurchbewegen kann, wie man radikalen Formen der Ablehnung, die politisch, ethisch, aber auch erkenntnistheoretisch ist, Substanz verleihen kann; wie man ihr durch Formen der Territorialisierung, die konspirative Orte, Zonen der offensiven Undurchsichtigkeit entstehen lassen, Beständigkeit verleiht.
Was offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass wir uns immer noch auf einer hypothetischen Ebene bewegen, die hauptsächlich von der Negation geprägt ist (gegenüber der klassischen Bewegungspolitik usw.) und die immer noch darum ringt, affirmative Hypothesen zu schärfen.
Die Arbeit, die noch zu leisten ist, besteht darin, zu versuchen, über die Erfahrungen nachzudenken, die wir machen können, und dabei den Kontakt zu den Formen der Desertion aufrechtzuerhalten… andererseits besteht die komplexeste Herausforderung darin, nicht aus Bequemlichkeit in Beziehungs- und Organisationsformen zurückzufallen, die wir am Besten kennen, aus Faulheit auf das Vertraute zurückzugreifen.
[Übersetzung aus dem Italienischen]
2 Es scheint mir klar zu sein, dass der Medienaktivismus von Soulevement de la Terre wie auch anderer Bewegungen schließlich in der Konsolidierung eines Kräfteverhältnisses stecken geblieben ist, in dem die Polizei nicht davor zurückschreckt, Tote zu hinterlassen. Die großspurigen Ankündigungen von „internationalen Aktionen“ haben keinen wirklichen Mobilisierungseffekt, sondern führen zu einem beeindruckenden Aufgebot an Polizeikräften, die jede andere Form von Aktion als die der Performance eines sozialen Netzwerks verhindern.
3 Im italienischen Original steht hier “potenza di agire”. Das Wort Potenza beinhaltet eine kaum zu übersetzende Doppeldeutigkeit von Macht und Möglichkeit. Es bezeichnet nicht die herrschende oder konstituierte Macht, sondern eher so etwas wie ein (noch) nicht eingelöstes Potential.
4 Ob ideologisch oder auf Kategorien wie “race” und Klasse bezogen, wie im Fall der ethnischen Komplexität, die die Momente der Revolte nach dem Tod von George Floyd in den USA belebte, mit einer signifikanten Präsenz weißer Randalierer, die jede rassistische Erklärung der Unruhen sowie bestimmte dekoloniale Lesarten, die nur für einige akademische Papiere gut sind, widerlegt.
5 Mario Tronti: On destituent power, online unter https://illwill.com/on-destituent-power.
6 Adrian Wohlleben: Memes ohne Ende, online unter https://non-milleplateaux.de/memes-ohne-ende/
7 Ähnlich haben wir dies begründet in: Strategia della separazione, online unter https://www.nigredo.org/2024/02/10/la-strategia-della-separazione/, sowie in einem anderen Text von Michele Garau: Senza perché, online unter https://archivioanomia.it/senza-perche/
8 Giorgio Cesarano und Gianni Collu: Apocalisse e Rivoluzione, Elfte These.
9 Ein interessanter Reflexionsvorschlag darüber, wie das Interstitielle zu denken wäre, wurde in diesem Text von einigen Freunden aus Quebec entwickelt: https://lundi.am/Conspiration-et-interstice [Interstitiell kann in etwa als “Zwischenräume bildend” übersetzt werden. Um das theoretische Konzept, das unter anderem auf Erik Olin Wright zurückgeht zu kennzeichnen, belasse ich es hier beim Fremdwort, Anm. d. Ü.]
10 Auf den Seiten des Blogs Nigredo wurde diesem Thema bereits viel Raum gewidmet. https://www.nigredo.org/2024/02/25/la-verita-circolare-dellinformazione-e-la-sua-negazione/
11 Wissenschaftler und Regierungen als neue Priester, die 20-Uhr-Nachrichten als neue Messen. Statistische Kurven und Diagramme als die neue Bibel, die es zu interpretieren gilt.
12 Digitaler Covid-Impfausweis.
13 Auch wenn viele von ihnen schnell identifiziert und verhaftet wurden, da sie Szenen der Plünderungen auf ihren Instagram-Profilen gepostet hatten.
14 Diese Überlegungen finden sich bereits in Memes ohne Ende.
15 https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/11/des-etudiants-d-agroparistech-appellent-a-deserter-des-emplois-destructeurs_6125644_3244.html
16 Dazu: https://www.nigredo.org/2024/07/04/760/
17 Mouvaise Troupe: Contrade. Storie di ZAD e NoTav. Hugh Farrel: Die Strategie der Zusammensetzung, https://bonustracks.blackblogs.org/2023/05/22/die-strategie-der-zusammensetzung-part-1/
18 Nicolò Molinari: Die Wellen brechen, https://www.magazinredaktion.tk/docs/alchemie.pdf
19 Michele Garau, «Ciò che sfugge alla menzogna è poca cosa». Note su Dionys Mascolo. https://www.machina-deriveapprodi.com/post/ci%C3%B2-che-sfugge-alla-menzogna-%C3%A8-poca-cosa-note-su-dionys-mascolo
20 Michele Garau: The strategy of separation. https://www.illwill.com/separation
21 Dionys Mascolo: Le communisme, S. 558.
22 Anonimo: Riconnessioni. Per un’ecologia della presenza https://vitalista.in/2021/02/06/riconnessioni/