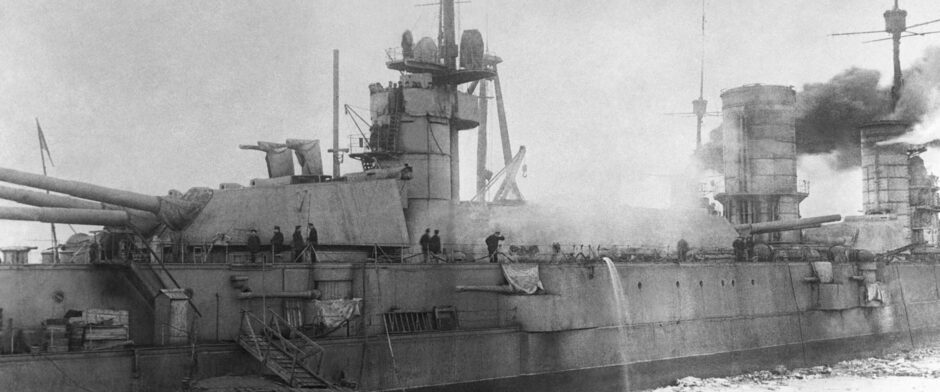Wo wollen wir kämpfen? — Wie wollen wir kämpfen? — Mit wem wollen wir kämpfen? — Was also könnte Politik sein?
Ich möchte mich diesen Fragen über drei Punkte nähern. Zum einen über eine Erfahrung bzw. einen inneren Konflikt mit mir am Beispiel der Pro-palästinensischen Proteste in Berlin, zum anderen über den Begriff des „Siegens“ und drittens über den Punkt der Hoffnung.
Mir geht es bei erstem Punkt in erster Linie nicht um eine Einschätzung des historischen Konflikts und den aktuellen Krieg, sondern für mich um die Produktivität, die die ganze Kontroversität und der spezifisch deutschen Kontroversität, bedeutet in der Umkreisung dieser Fragen.
Als die Proteste begannen, war ich froh, dass Menschen das eiserne Schweigen der deutschen Staatsräson unterbrachen und ich war neugierig. Neugierig, weil Menschen, unabhängig davon, ob sie sich mal klassisch bürgerlich in Demonstrationen und im öffentlichen Diskurs oder auch unversöhnlicher auf der Straße mit gezielten Angriffen auf die Bullen artikulierten, zusammen kamen, die ich nicht einschätzen konnte. Klar konnte ich mir eine Idee davon machen, warum die jeweils einzelnen Gruppen, der Palästinenser, Muslime, trotzkistischer Splittergruppen oder postkolonialer Studierender an den Protesten teilnahmen bzw. teilnehmen, aber bereits bei sich als explizit queer, jüdisch oder sich irgendwie aus der antideutschen Ecke verstehender Menschen wurde es für mich schwieriger. Denn, dass für einige die Hamas ein positiver Bezugspunkt als einziger Widerstandsgruppe, war und ist, ist ja auch Fakt. Ich war also auf diese Gemengelage von unterschiedlichen Menschen, jungen Frauen mit Kopftuch, queeren AkademikerInnen, JüdInnen, deutschen Linken, Expatriots und arabischen Menschen so neugierig, deren Zusammensetzung mir so abwegig erschien. Worauf will ich politisch hinaus? Ich möchte drei Punkte nennen:
Wir fallen immer wieder hinter die berechtigte Zurückweisung unserer klassischen politischen Kategorien oder zumindest ihrer Infragestellung zurück, wenn sogenannte linke Akteure in Protesten auftreten. Beginnen also erneut sie in den Maßstäben linker Kategorien zu bewerten. Aber es muss gerade darum gehen, sich die Proteste ohne diese Kategorien anzuschauen, also quasi die linken Akteure zunächst nicht als solche zu sehen. Ansonsten verpassen wir die untergründige gemeinsame Erfahrung in den Protesten, das was über das offensichtlich politisch linke hinaus geht. Und das sollte ausschlaggebend sein für das eigene Gefühl und letztlich die Entscheidung sich zu beteiligen oder nicht. Denn was war diese gemeinsam geteilte Erfahrung, die ich intuitiv auch gefühlt habe, warum es mich zu diesen Menschen, bei all meinen bösen Gedanken wenn ich an Akademiker, Queer-theorie, Postkoloniale Theorie oder den Machismus der StreetKids denke, hingezogen hat, die ich aber mit meinen klassischen Denkkategorien von „Antisemitismus“, „regressiver Antiimperialismus“, usw. politisch-analytisch verdrängt habe. Bifo Berardi schreibt dazu in einem Interview was die heutigen Unibesetzungen in den USA von denen der 68er unterscheidet: „Meiner Meinung nach identifizieren sich die Schüler mit der Verzweiflung. Verzweiflung ist die psychologische und auch kulturelle Eigenschaft, die die breite Identifikation der jungen Menschen mit den Palästinensern erklärt. Ich denke, dass die Mehrheit der Studenten heute bewusst oder unbewusst eine unumkehrbare Verschlechterung der Lebensbedingungen, einen unumkehrbaren Klimawandel, eine lang anhaltende Periode des Krieges und die drohende Gefahr einer nuklearen Niederschlagung der Konflikte, die an vielen Stellen der geopolitischen Landkarte im Gange sind, erwartet. Darin liegt meines Erachtens der Hauptunterschied zur 68er-Bewegung: Eine Umkehr des Kräfteverhältnisses ist nicht in Sicht.“ Und ist nicht die Suche nach Menschen, die eine Erfahrung mit einem teilen, und damit meine ich nicht eine oberflächliche politische oder ökonomische Erfahrung, sondern ein grundsätzliches Verhältnis zur Welt, aktuell der entscheidende Punkt? Auf Dauer ist das natürlich zu wenig und es braucht darüber hinausgehend auch ein gemeinsames Verständnis der Welt, eine Reflexion der geteilten Erfahrung, denn ansonsten kann es uns passieren beim Parteitag einer Neurechten Partei zu landen. Nichtsdestotrotz ist die geteilte Erfahrung aktuell als Ausgangspunkt entscheidend, weil alles am Boden liegt und wir neu herausfinden müssen mit wem wir, wo, wie leben und kämpfen wollen.
Insofern lassen sich die Antworten auf die Fragen nicht strategisch bestimmen oder definieren. Der Ort ist richtig, wenn wir uns entscheiden ihn zu unserem Ort zu machen und dies andere auf ähnliche Art und Weise machen. Darin entscheidet sich dann auch, ob es zu einem strategischen Ort wird, oder ob es „nur“ für mich ein Ort wird. Auch das ist viel, weil ich darin wieder lerne zu kämpfen (im klassisch taktischen Sinne, im Sinne des Kämpfens um das was ich bin, was andere sind und wie wir uns in Beziehung setzen). Und daran anschließend der dritte Punkt: Wird es zu einem strategischen Ort, haben wir eine Non-Bewegung. Die Non-Bewegungen lassen sich also nicht analytisch entdecken, maximal vielleicht eine Ahnung von ihnen kriegen (aber auch das ist nicht der Analytik geschuldet, sondern der Fähigkeit eine Grunderfahrung mit Menschen teilen zu können), sondern nur durch die Menschen darin zu solchen machen.
Ich glaube, es ist notwendig sich auf diese Art den Dingen zu nähern. Die geteilte Erfahrung und sie zu theoretisieren bedeutet für jeden etwas anderes, aber nur so vertiefen und erweitern wir unsere Erfahrungen, werden darin eben gemeinsam klüger, nähern uns von verschiedenen Seiten, Orten und Menschen dem Wesentlichen. Nun stellt sich natürlich sofort die Frage, warum ich das erzähle, warum sollte man sich in dieser Form zu Geschehnissen, Protesten etc. verhalten. Weil ich glaube, dass es ein erster Schritt dahin ist, die Bedingungen der Möglichkeit zu schaffen, wieder zu siegen. Ich schließe mich also der Formulierung in Bulletin No. 5 an: ich will immer noch siegen: Ich will in Freiheit leben, ich will das andere in Freiheit leben können, ich will Gerechtigkeit für all die Ermordeten durch das System. Was aber heißt es zu siegen? Meiner Meinung nach kann es nicht seine Bedeutung im landläufigen Sinne sein, also der Sieg als Prozess des Kampfes, in dem man die Macht erlangt den anderen Niederzuwerfen (im äußersten Fall sogar zu vernichten), und sich an seine Stelle stellt, politischer gesprochen den Aufstand zu wagen, darin eine konstituierende und letztlich konstituierte Macht zu werden, oder philosophischer gesprochen vom Knecht zum Herr werden. Denn was bleiben würde ist Herrschaft unter umgedrehten Vorzeichen. Der Herr wird zum Knecht und der Knecht zum Herr. In der Linken wird zwar von unterschiedlichen Ausgangspunkten, aber immer in diesem oben genannten Verständnis von „Siegen“ geredet, nur das man es in schöne Vokabeln wie wahlweise Hegemonie, Gegenmacht, Basisarbeit, Insurrektionalismus verpackt. Das führte, nachdem was wir wissen zu den historischen Fehlern der Anarchisten, Bolschewiki und Allen, die ihnen nachfolgten. Historische Fehler zu machen ist legitim, reproduziert man sie aber dann weiter ist es Dummheit und Opportunismus. Was heißt es also siegen zu wollen? Bzw. wie können wir anders über das Siegen nachdenken? Ich denke, es hat mit Macht bzw. damit zu tun, Sieg ohne Macht zu denken. Das ist finde ich ziemlich schwierig, weil es so fest im Kopf ist, dass man Sieg immer in der Niederwerfung des Anderen denkt. Zwei miteinander eng verknüpfte Vorschläge, die ich interessant finde, sind die des Lebens „als-ob-nicht“ und des Entzugs, des „i would prefer not to“; dabei beziehe ich mich vor allem auf Marcello Taris Buch „Unhappy Revolution“. Was bedeutet das also?
Zu leben als-ob-nicht, als ob die Gesetze nicht gelten würden, als ob man bereits gesiegt hätte.
Angesichts der historischen Niederlagen der Linken gibt es, und ich glaube zu recht, den Versuch sich über eine andere Tradition den gleichen Fragen zu nähern; wie beispielsweise Badiou, Zizek, Agamben und Tari. In der Bibel tauchen häufig Motive auf, in denen Menschen, ob Jesus oder Paulus, so tun als ob sie bereits gesiegt hätten. Es geht darin nicht um das „siegen zu wollen“, sondern um das „Bereits gesiegt zu haben“: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, und Gott, was Gott ist, Tempelsituation mit Jesus, Palmwedel und Einritt in Jerusalem, Heilungsgeschichten Jesu. Insofern beinhaltet dieses „Als-ob-nicht“ nicht nur die juristischen Gesetze, sondern die Verfasstheit unserer Gesellschaft. Man lebt als ob der stinkende Obdachlose in der U-Bahn kein Ausgestoßener und Verachteter dieser Gesellschaft ist. Insofern ist das „als-Ob-Nicht”, „als-ob-wir schon gesiegt hätten“, immer schon auf die Schwachen, Armen und Dissidenten bezogen. In diesem Sinne bedeutet Siegen, sich dem Schwachen, nicht dem Starken zuzuwenden. In der Bibel gipfelt das nicht-intentionale Verhalten zum Sieg in der Kreuzigung und Auferstehung Jesus, dem wahrhaften und nicht intentionalen Sieg. Ich glaube dieser letzte Plottwist der Bibel ist zentral, weil er das Schwache zum Starken macht, und uns vor der Sklavenmoral schützt.
Das „I would prefer not to“ geht in die gleiche Richtung, allerdings mit einer anderen Nuance: es ist die Haltung mit „i would prefer not to“ jegliche Verführung von Realpolitik, jede Verstrickung in vermeintliche diskursive Widersprüche, jede Gefahr die im Siegenwollen besteht mit einem einfachen Nein abzulehnen. Dieses Nein ist nicht inhaltlich begründet, sondern maximal durch das abstrakte Prinzip des schlicht und ergreifenden „Nicht-Wollens“ begründet.
Dieses leben als-ob-nicht, als ob man schon gesiegt hätte und „i woud prefer not to“ ist weder eine Aufforderung zur Laisszefaire-Haltung. Weder eine zum Anarcho-primitivistischen Rückzug noch zu einem Aufreiben in den Verstrickungen der Herrschaft. Es erfordert eine permanente Anstrengung bzw. Auseinandersetzung, weil es sonst zu einer egal-Haltung führt. Es erfordert eine permanente Überlegung was dieses „Als-ob-Nicht“ bedeuten könnte bzw. ein Wissen darüber, was Herrschaft und Macht ist. Das Als-ob-nicht bleibt insofern leider auf das Gesetz bezogen. Konkret: Bedeutet das Als-Ob-nicht andauernd schwarz zu fahren, weil man meint, dass sich hier ein zentraler Wesenszug der Herrschaft äußert? oder ist gerade das Ticketkaufen nicht genau die Parole „gebt dem Kaiser was des Kaisers ist“? Das ist eine individuelle und gemeinsame Debatte bzw. eine Konkretisierung in der einzelnen Lebensform, wo jeder selbst in einer ernsthaften Entscheidung wissen muss, was es für ihn/sie bedeutet das Als-Ob-Nicht zu tun. Darin besteht eine Chance uns aus unterschiedlichen Richtungen, Erfahrungen und Wissen uns diesem Als-Ob-Nicht zu nähern.
Macht es dann noch Sinn von Sieg zu reden? Ich bin mir nicht sicher, mir missfällt dieser Begriff. In diesem Sinne ebenfalls mit Tari: Besser Verlierer als Verlorene sein.
An das Siegen schließt die Hoffnung an:
Die einen werfen der Hoffnung vor, dass sie uns in eine Haltung des Wartens verdammt, in der wir das mögliche und notwendige auf eine ungewisse Zukunft verschieben, die Hoffnung uns also zu einem Leben im kapitalistischen Normalzustand verleitet. Die anderen werfen der Hoffnungslosigkeit vor, dass sie uns wahlweise zu Nihilismus verleitet oder zu einer identitären Wohlfühlpolitik in der heilen Welt der Kommune.
Ich würde die Hoffnung gerne aus dieser falschen Dichotomie retten und behaupten, dass weder Hoffnungslosigkeit Nihilismus bedeutet, noch Hoffnung die Flucht in die Zukunft. Beide Positionen einmal in ihrem Bezug auf die Gegenwart und einmal in Bezug auf die Zukunft, gehören zusammen. Dann wäre Hoffnung eine Zukunftseinstellung, die über das Wünschen hinausgeht, die nicht in die Zukunft flieht, sondern das Künftige in das Jetzt hereinholt. Die oben genannte Dichotomie wäre dann gar keine Dichotomie, sondern das Gleiche, nämlich Verzweifelung und Warten ins Leere hinein. Hoffnung entsteht aus der Gegenwart und ist eine feste Gewissheit (z.b. dass solange zwei Menschen existieren Kommunismus möglich ist) in Bezug auf Dinge, die unklar und unbekannt sind.
An diese Gedanken zur Hoffnung, in der es ja auch um Zeitvorstellungen geht, möchte ich zum Ende deswegen noch ein paar kurze Gedanken zur Zeit anschließen. Tari schreibt, dass die Zeit des Kapitals immer durch eine frenetische Beschleunigung gekennzeichnet war, auch um der Revolution nicht die nötige Zeit zu verschaffen – und damit die subjektive Entwicklung verlangsamen. Man könnte also sagen, dass die kapitalistische Zeit durch diese frenetische Beschleunigung genau das Nachdenken über Hoffnung verunmöglicht und uns in die falsche, nämlich seine Dichotomie von Zeit und damit Hoffnung vs. Hoffnungslosigkeit treibt. Daher müsste es darum gehen die kapitalistische Zeit im Sinne des „Als-ob-nicht“ und „i would prefer not to“ zu verlangsamen und unsere Ungeduld, nicht aber die Dringlichkeit, aufzugeben. Es geht also darum „Zeit zu haben“, d.h. Abstand von der Gegenwart zu schaffen“: Man sieht die Dinge nur aus der Ferne … wer in der Mitte der Dinge bleibt, lernt nichts“ (Tari)
Danke