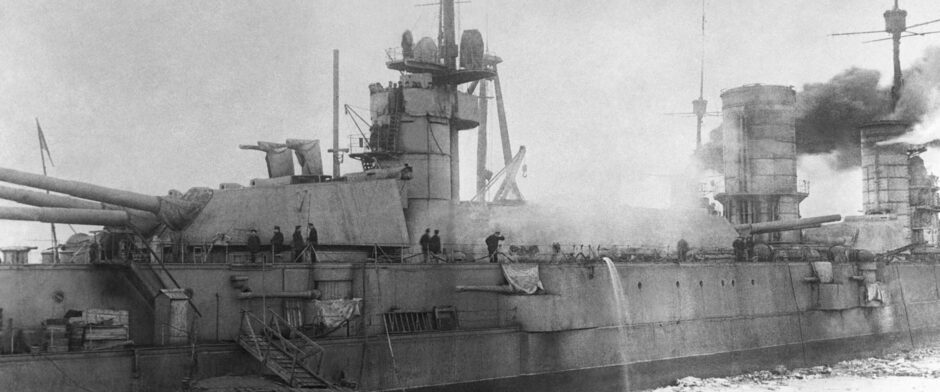„Unsere Stärke liegt ganz in dieser Gewissheit: Wir haben keine Zukunft zu verkaufen, sondern nur eine Gegenwart zu spielen. Es sind die Pfarrer, die die Zukunft verkaufen.“
„Von demjenigen, der nicht einmal der schrecklichen Heimsuchung seiner eigenen Ohnmacht erliegen will, und nur von diesem, ist noch alles zu erwarten, und an erster Stelle die Überwindung der Ohnmacht.“
Cesarano, Was man nicht verschweigen kann.
Mein Beitrag geht von der Frage „Ist dies das Ende der Politik?“ aus. Ich glaube, dass eine solche Frage eine Besorgnis ausdrückt, die sich all jenen aufdrängt, die sich in einem Umfeld bewegen, das sich auf eine sogenannte revolutionäre oder radikale Tradition beruft. Diese Sorge ist zweifellos mit der Unmöglichkeit verbunden, nicht anzuerkennen, dass die Welt durch das Kapital totalisiert wurde, dass diese Totalisierung weitergeht und dass ihre letzten Veränderungen eine „Krise der Objektivität“ hervorgerufen haben, der niemand zu entkommen scheint. Mit Krise der Objektivität meine ich, dass alle modernen Externalitäten der Totalität, auf die sich die verschiedenen revolutionären Projekte des 19. und 20. Jahrhunderts bezogen, die Arbeit, der Gebrauchswert, die Wirtschaftskrise, das Proletariat, die Natur usw., ihre Qualität als Externalitäten verloren haben. Ihre ontologische Relevanz, d. h. ihre Fähigkeit, die Realität zu erfassen, hat die revolutionäre Debatte strukturiert. Heute werden sie nicht nur zunehmend als integriert deklariert, sondern aufgrund dessen, was Cesarano bereits 1973 die Entwicklung eines selbstkritischen Kapitals nannte, beginnt die Debatte selbst, die einem sogenannten revolutionären Milieu seine ganze Konsistenz verlieh, ihre Daseinsberechtigung zu verlieren, je mehr sie sich verschiebt, öffnet und spektakulär wird. Mit anderen Worten: Die Öffentlichkeit, anstatt von und aus einer Infraöffentlichkeit heraus angegriffen zu werden, hat diese letztere eingeschlossen. Das bedeutet, dass wir eine solche Debatte nur sehr schwer wiederbeleben können, selbst wenn wir die Grundlagen einer Tradition hinterfragen, zu der wir eine Zugehörigkeit beanspruchen würden. Um dies zu tun, werden wir immer mehr in den Rahmen einer öffentlichen Debatte gedrängt, insbesondere in den der sozialen Netzwerke, die, ohne notwendigerweise dort zu sein, eine ständige Selbstaufwertung beinhalten, deren Inhalt durch Spekulationen über die Erwartungen der Zuschauer vordefiniert wird. Der Revolutionär ist dann nicht anders als jeder andere in dieser Welt. Entweder er tritt auf der Stelle, fühlt sich dringend zur Tat gedrängt, ist aber gleichzeitig von der Nichtigkeit seiner Tat überzeugt. Er versucht allenfalls, seinen Rückzug zu theoretisieren. Damit unterscheidet er sich gar nicht so sehr von allen Alternativen, Newages oder dem, was sich hinter dem „quiet quitting“ abspielt. Entweder konvertiert er zur letzten Lebensform des Kapitals: dem Spieler. Der Spieler glaubt an nichts anderes als an sein eigenes Kapital, das er so weit wie möglich zu vermehren sucht. Sein Widerspruch besteht darin, dass er notwendigerweise annehmen muss, was er verneint, nämlich eine oder mehrere Totalitäten, in denen solche Kapitalien getauscht, zirkuliert usw. werden können, und dass jeder das gleiche Spiel spielt wie er, obwohl es ein Nullsummenspiel ist. Er hat also eine gewisse Wahrheit erlangt, nämlich eine Desillusionierung hinsichtlich des Handelns oder Nichthandelns und die Reduzierung desselben auf mehr oder weniger effektive Strategien zur Vermehrung des eigenen Reichtums auf Kosten anderer. Die Frage „Ist das das Ende der Politik?“ zeugt von einer Unruhe, die weder in einer schmerzhaften Zwischenwelt stecken bleiben, noch zur letzten Lebensform des Kapitals konvertieren will. Um zu versuchen, diese Frage zu beantworten, werde ich versuchen, sie in drei weitere Fragen zu übersetzen, die sowohl theoretisch als auch existenziell sind: „Ist die Revolution noch möglich?“, „Wenn ja, kann eine politische Aktivität noch öffentlich sein?“ und „Kann ich hoffen, mir selbst und anderen aus einer Existenz heraus zu erscheinen, die hauptsächlich durch die Politik definiert wird?“.
I. Ist eine Revolution noch möglich?
a. Wenn Sie gestatten, möchte ich hier versuchen, den Begriff der Revolution so zu verstehen, wie Jacob Taubes ihn versteht, nämlich als Apokalyptik, als Umgestaltung der Welt in ihrer Gesamtheit, als Ersetzung einer Welt durch eine andere und als Offenbarung eines solchen Prozesses. Diese apokalyptische Politik beinhaltet sowohl eine Zerstörung des Bestehenden als auch den Aufbau von etwas anderem. Seit Marx wird eine solche Bewegung mit der des Proletariats in Verbindung gebracht. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass es der Arbeiterschaft seit den 1920er Jahren nicht gelungen ist, sich gegen die Welt des Kapitals durchzusetzen. In Wirklichkeit ist das einzige historische Vorkommen einer Ablösung einer oder mehrerer Welten durch eine andere der Prozess des Kapitals selbst. Im Laufe seiner Entwicklung hat das Kapital immer wieder alle Voraussetzungen, die es hervorgebracht hat, untergraben und durch eigene Grundlagen mit universellen Ansprüchen ersetzt. Diese werden durch den Prozess der Kapitalbewegung selbst immer wieder in Frage gestellt, so dass das Kapital zu dieser apokalyptischen Macht wird, die gleichzeitig zerstört und aufbaut. Seit einigen Jahren sind beispielsweise die langsame und schwierige Ersetzung der Ökonomie durch die Ökologie, die Entfaltung von Technologien, die immer unsichtbarer, dualer und allgegenwärtiger werden, sowie die Häufung von Situationen, die einen potenziellen Weltkrieg begünstigen, Elemente, die es ermöglichen, die neue revolutionäre Tendenz des Kapitals zu erfassen: sich seiner modernen metaphysischen Annahmen zu entledigen, nämlich der Trennung von Natur und Kultur, die es nun daran hindert, seinen Totalisierungsprozess fortzusetzen. Aus der Sicht des Kapitals entspricht das Jenseits der Katastrophe. Seine Eschatologie ist daher rein negativ, denn die Aktualisierung dieses Jenseits existiert nur, um die Welt des Hier und Jetzt zu verewigen. Der Prozess des Kapitals kann daher als die Offenbarung einer permanenten Revolution gesehen werden, in der sowohl die Zerstörung der Welt als auch ihre Erhaltung instituiert wird.
Dieser revolutionäre Prozess, diese Eschatologie, ist das Ergebnis von Politiken, d.h. von Strategien zur Organisation des Lebens durch verschiedene Fraktionen des Kapitals, die sich mal verbünden, mal bekämpfen. Daran ist nichts automatisch und es gibt keinen Nettoplan des Kapitals. In diesem Sinne ist es nicht das Ende der Politik. Die allgemeine Bewegung, an der wir manchmal teilnehmen, d.h. diese Bereitschaft zur Verfügbarkeit, ist nie ohne Bezug zur Ankündigung der Katastrophe. Alle politischen Praktiken, die im öffentlichen Raum sichtbar werden, auch die protestantischen, auch die, die die Organisation des Lebens durch die Fraktionen des Kapitals ablehnen, mobilisieren sich im Namen einer solchen Ankündigung. Denn nur der Bezug auf eine solche Ankündigung macht sie legitim, gibt ihnen einen Grund, einen Eindruck von Konkretheit. Sie können nicht ohne eine solche Legitimität auskommen, denn die Ersetzung der Welten durch die Totalität des Kapitals hat einen von allen geteilten, gemeinsamen Kontext hervorgebracht, eine Menschheit, von der es unhörbar geworden ist, sich abzugrenzen. Dadurch zeigt sich die Politik in ihrem mobilisierendsten Aspekt, in ihrem kultischen Charakter. Wir verwechseln das apokalyptische Szenario des Kapitals – die objektive Möglichkeit des Weltuntergangs durch irdische Grenzen und einen neuen Weltkrieg – mit der Apokalypse unserer Zeit: der Offenbarung eines revolutionären Kapitals als der einzigen aufrichtig erfahrbaren Transzendenz. Eine solche Transzendenz ist keine neue Wahrheit, sondern die Wahrheit des Unwahren, ihre Effektivität.
Die Frage „Ist das das Ende der Politik?“ zu stellen, zeugt also von zwei Dingen: einerseits von der Schwierigkeit, eine politische Praxis außerhalb der von den Szenarien der Kapitalfraktionen auferlegten Dringlichkeit in Betracht zu ziehen, und andererseits von der Schwierigkeit, eine nicht eschatologische Politik in Betracht zu ziehen, sobald die Apokalypse durch denselben Prozess verwirklicht wird, den es traditionellerweise zu zerstören galt. All dies zwingt uns, zwei Arten von Politik zu unterscheiden: eine eschatologische, die historisch unfähig war, sich auf die andere Welt zu berufen, auf die sie sich bezog, um das Diesseits abzulehnen, und die nun, um sich zu erhalten, nur die andere Welt akzeptieren kann, die vom Kapital beschworen und verwirklicht wird. Die zweite, die mir auch heute noch schwer zu benennen scheint, ist in erster Linie eine Politik der Erfahrung. Sie wurzelt in dem Ziel, das sie sich setzt, nicht also aus einer anderen Welt heraus, sondern nur „aus dem Leben der Vergänglichkeit“, also aus einer Aufmerksamkeit für das, was hier ist. Als Aufmerksamkeit findet sie ihre Gründe zunächst in der Gegenwart. Diese wird jedoch von der Vergangenheit erhellt, nicht als etwas Gegebenes, das es zu bewahren oder wiederzufinden gilt, sondern als etwas zu Eroberndes, das nicht müde wird, neu definiert zu werden, und das nur in Bezug auf das, was lebt, existiert. Von der Zukunft oder einem anderen Ort kann sie nichts erwarten, sie sieht nur das Schlimmste, um es in der Gegenwart abzuwenden und Freude zu finden. Sie erkennt also in der Wahrheit des Totalisierungsprozesses eine Objektivität, die sich allen aufdrängt, aber eine rein negative Objektivität, auf die niemand wirklich Anspruch erheben kann. Ich werde versuchen, mich für den Rest des Beitrags auf diese Politik der Erfahrung zu konzentrieren und nicht auf die eschatologische Politik, die ich nur für negative Zwecke mobilisieren werde.
2. Den öffentlichen Raum aufgeben?
Ich habe also begonnen, die Frage „Ist dies das Ende der Politik?“ zu beantworten. Dennoch ist meine Antwort auf die Frage „Ist eine Revolution noch möglich?“ nicht eindeutig. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Politik der Erfahrung eine revolutionäre Politik ist, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Diese Nicht-Antwort, d. h. die Antwort, die vorschlägt: Die Revolution wurde vom Kapital durchgeführt und wird weiterhin durchgeführt, ist absolut unbefriedigend für das gegenwärtige Verlangen nach Kommunismus wie auch für alle, die in der Vergangenheit die Leidenschaft hatten, die Welt zu verändern.
Ich glaube, wir befinden uns in einer Zeit, in der eine solche Frage in einem öffentlichen Raum nicht eindeutig beantwortet werden kann. Nicht, weil die Revolution das wäre, „worüber man nicht sprechen kann“, sondern weil sie nicht mehr etwas ist, das in der Sphäre der Öffentlichkeit erfasst werden kann. Die Öffentlichkeit hat sich historisch als Ort der Ausübung einer Gegenmacht der Bourgeoisie gegenüber der Aristokratie aufgebaut. Sie ist der Raum, in dem sich die Gesamtheit der Privatpersonen, die eine Öffentlichkeit bilden, an die Macht und aneinander wenden. Sie ist konstitutiv für die Schaffung des Marktes und die Entfremdung des Tausches durch ihn. Sie hat beansprucht, und dies oft mit einer gewissen Effizienz, der Ort zu sein, an dem eine Kritik der Macht im Namen eines allgemeinen Interesses, des Universellen, aufgebaut wird. Dadurch musste sie im Laufe der Geschichte eine immer größere Gruppe von Bevölkerungsgruppen einbeziehen, über die die Macht ausgeübt wird. In Wirklichkeit scheint es mir wichtig zu erkennen, dass das Universelle immer nur die höfliche und scheinheilige Darstellung des Wunsches eines bestimmten Interesses war, andere Interessen zu unterdrücken. Heute genießt der öffentliche Raum immer noch ein solches Prestige, obwohl er für alle immer offensichtlicher als Herrschaft der Manipulation erscheint. Die einzige Möglichkeit, sich als hegemonialer Raum für den Ausdruck der gesamten menschlichen Sprache zu behaupten, besteht in der Höflichkeit in einem riesigen Haufen Zynismus. Alle, die nicht mitspielen, werden nach und nach ausgeschlossen.
Die Frage der Revolution ist seit dem Faschismus in Italien und Deutschland oder der Volksfront in Frankreich aus der Werbung verbannt worden. Es ist also fast 100 Jahre her, dass sie in diesem Raum nicht mehr existierte. 1968 und die darauf folgenden Jahre in Italien waren der erfolgreichste Versuch, das Thema wieder in den öffentlichen Raum zu bringen. Man könnte sagen, dass damals, als der revolutionäre Prozess des Kapitals eindeutig zum Ersatz von Welten durch eine andere wurde, ein letzter Ruck diese Welten erfasste, um zu versuchen, sie im Namen der Kategorie des Universellen öffentlich zu kritisieren. Heute äußert sich die Krise der Objektivität, die wir durchlaufen, gerade in der Unmöglichkeit, sich weiterhin positiv auf das Universelle zu beziehen, was eine völlige Abtrennung der politischen Aktivität – die keine eschatologische politische Aktivität ist – von der öffentlichen Sphäre impliziert.
Eine Politik der Erfahrung kann daher in einer solchen Situation nur klandestin gegenüber dem öffentlichen und sozialen Leben sein. Eine solche Heimlichkeit ist nicht ihr Ziel, sondern die Folge dessen, was einige als die tatsächliche Subsumtion des Kapitals unter die Gesellschaft bezeichnet haben mögen. In einer solchen Situation bewegt sich die politische Aktivität nicht mehr aus den bürgerlichen Freiheiten der öffentlichen Meinungsäußerung oder der Meinungsfreiheit heraus. Das Einzige, was noch zu tun bleibt, ist, die Begegnung zu organisieren.
Man muss sagen, dass der Begriff der Begegnung zu einer Art Passwort geworden ist. Meine Freunde und ich sehen darin eine Lösung für den Stillstand, die Heuchelei und den Zynismus. Sie wird zu einem Ereignis, das in unserer Reichweite liegt, das machbar ist, ohne dass es einen Werbeanspruch gibt. Sie ist das, was über die aufgezwungenen Beziehungen hinausgeht, und das, was hier das Mögliche ohne Utopie eröffnet, sie stärkt uns. Die Begegnung ist also ein realistischer Ausgangspunkt. Und dieser Realismus entsteht gerade aus einer Klarsicht nicht nur auf unsere eigene Ohnmacht, sondern auch auf unser Bedürfnis und unseren Wunsch, uns nicht darin zu suhlen. Diese Notwendigkeit der Begegnung macht umso mehr Sinn, als seit der Gesundheitspolitik von 2020 die Trennung, die im Allgemeinen als Folge von Verdinglichungsprozessen erschien, zu etwas bewusst Organisiertem auf der ganzen Welt geworden ist.
Allerdings kann man in der Mystik der Begegnung bereits einen gewissen „Solutionismus“ erkennen, denn die Begegnung wird oft zur kärglichen, unteilbaren Beute der Zufälle des Lebens. Man kann sie nicht so organisieren wie Manager, die Teambuilding betreiben wollen, oder Heiratsvermittler. In diesem Zusammenhang haben China und die Stadt Tokio für 2023 und 2024 eigene Dating-Apps entwickelt, während man in Frankreich und Deutschland einige Stimmen hört, die ein Freundschaftsministerium vorschlagen. Komischerweise ist die Begegnung auch das, was in unseren eigenen Niederlagen den letzten Grund liefert, die Verdoppelung der Welt, an der wir gerade teilgenommen haben, nicht in Frage zu stellen: da wir zumindest „dort Begegnungen gemacht haben“. Wenn die Politik der Erfahrung strategisch einer Politik der Begegnung entspricht, d. h. dafür zu sorgen, dass, wie Andy Merrifield es definiert und wie es für die jüngsten Demonstrationen im Iran beschrieben wurde, die Körper, die sich begegnen, dies in der Modalität einer Kettenbegegnung tun (eine Begegnung zieht eine andere nach sich, die ihrerseits weitere nach sich zieht usw.), müssen zwei Dinge in Angriff genommen werden:
a. Das erste ist eine negative Definition der Organisation der Begegnung, die sie nicht sein kann, wenn sie nicht an der Verdoppelung der Welt teilnehmen will.
Die Organisation des Treffens kann nicht versuchen, in einem kleineren Rahmen eine alternative Öffentlichkeit zur Öffentlichkeit neu zu schaffen. Sie kann keine Paralleldebatte zur Debatte über das Universelle sein, deren Gegenstand ein Alteruniversum wäre. Denn das Konzept des Universellen selbst impliziert einen Kampf gegen jedes andere Konzept des Universellen. Wenn sie sich zum Ziel setzt, einen solchen Begriff besser als das Kapital neu zu definieren, würde sie, ob sie es will oder nicht, in Konkurrenz zur offiziellen Werbung treten. Letztendlich wäre sie nur ein Raum für den Aufbau einer Gegenhegemonie zur gegenwärtigen Hegemonie. Sie hätte nur ein Ende, wenn sie diejenige ersetzt, gegen die sie existieren will. Zu diesem Zweck wird sie nicht umhin können, sich dort vertreten zu lassen, und so kehren wir erneut zur eschatologischen revolutionären Politik zurück, und zwar auf eine umso lächerlichere Art und Weise, als niemand die Kraft hätte, der offiziellen Öffentlichkeit wirklich Konkurrenz zu machen. Mehr noch: Die Organisation des Treffens kann keine Alterspublizität sein, weil sie als öffentlicher „Underground“-Raum eine Geografie, eine Dimension schafft, in der negative Erfahrungen mit der Welt kapitalisiert werden können. Sie schafft eine Erweiterung des Marktes, wo jedes Wesen zu einem potenziellen Spieler und jeder Körper zu einem Kapital mit vielen Möglichkeiten wird. Der Wunsch, dabei zu sein, die Selbstaufwertung und der Transfer von Kapital, das lange Zeit in einem Milieu aufgebaut wurde, in ein anderes, weniger radikales Milieu sind alltägliche Dinge, auf die man meiner Meinung nach unbedingt verzichten sollte. Die Frage, die offen bleibt: Wie kann man das nicht tun?
b. Eine Möglichkeit, mit der Beantwortung dieser Frage zu beginnen, besteht darin, innerhalb der Strategie der Organisation von Begegnungen zwischen einer guten und einer schlechten Begegnung zu unterscheiden. Mit anderen Worten: Nicht jede Begegnung ist gut zu machen. Es geht also nicht darum, irgendetwas mit irgendjemandem zu organisieren. Deleuze zeigt uns in seiner Spinoza Philosophie Pratique vielleicht einen Weg, den wir einschlagen können.
„Derjenige wird als schlecht, als Sklave, als Schwächling oder als Narr bezeichnet, der von zufälligen Begegnungen lebt und sich damit begnügt, deren Auswirkungen zu erdulden, selbst wenn er jedes Mal stöhnt und anklagt, wenn die erlittenen Auswirkungen sich als gegenteilig erweisen und ihm seine eigene Ohnmacht offenbaren. Denn wenn man alles in jeder Beziehung trifft und glaubt, dass man immer mit viel Gewalt oder ein wenig List davonkommt, wie kann man dann nicht mehr schlechte als gute Begegnungen machen? Wie kann man sich nicht selbst durch Schuldgefühle zerstören und andere durch Groll zerstören, indem man seine eigene Ohnmacht und Sklaverei, seine eigene Krankheit, seine eigenen Verdauungsstörungen, seine Toxine und Gifte überall verbreitet? Man kann nicht einmal mehr sich selbst begegnen“.
Umgekehrt: „Der gute oder starke Mensch ist derjenige, der so voll oder so intensiv existiert, dass er zu Lebzeiten in die Ewigkeit geführt hat und dass der Tod, der immer extensiv, immer äußerlich ist, für ihn eine Kleinigkeit ist. Die ethische Prüfung ist also das Gegenteil eines aufgeschobenen Urteils: Anstatt eine moralische Ordnung wiederherzustellen, bestätigt sie schon jetzt eine immanente Ordnung der Essenzen und ihrer Zustände. Statt einer Synthese, die Belohnungen und Strafen verteilt, begnügt sich die ethische Prüfung damit, unsere chemische Zusammensetzung zu analysieren“.
Fasst man diese Zitate zusammen, so besteht der Unterschied zwischen guten und schlechten Begegnungen grob gesagt darin, dass der erste so existiert, dass er „zu Lebzeiten in die Ewigkeit geführt hat“, während der zweite die Begegnungen, die er macht, erleidet und die Schuld auf andere als sich selbst schiebt. Was bedeutet es, zu Lebzeiten in die Ewigkeit zu führen?
Sich die Frage nach einer guten Begegnung zu stellen, bedeutet also, die Organisation der Begegnung nicht unbedingt an die Bildung einer Gruppe oder eines Kollektivs zu knüpfen, wie wir es gewöhnlich tun. In Wirklichkeit geht es darum, bei jedem, aber zunächst bei sich selbst – als Körper – eine Fähigkeit zu etablieren (oder zu belauschen), die sich als eine Kunst der Unterscheidung und der Distanz zwischen dem, was für einen selbst gut oder schlecht ist, als eine Prüfung unserer Affekte und unserer eigenen Macht, zu beeinflussen, definieren ließe. Und, ich sage „zu Hause zuhören“, denn mir scheint, dass die Unfähigkeit, in unseren Kreisen „ich“ zu sagen, in der Regel dort liegt, wo alle Erwartungen gegen Wände laufen. Aus Ablehnung des Liberalismus haben wir uns gegenüber dem Aufbau von Egos blind gemacht, die auf magische Weise verschwinden würden, sobald eine Gruppe oder ein Kollektiv entsteht. Ich denke, das ist ein Fehler. Anders ausgedrückt: Die Organisation der Begegnung als politisches Handeln erfordert, die Politik unter eine Ethologie zu subsumieren, d. h. die Begegnung zwischen Dingen zu ermöglichen, die einander entsprechen. Dies impliziert, dass es von der Begegnung nichts zu erhoffen gibt. Sie ist an sich gut oder schlecht, sie erhöht oder verringert unsere Macht, sie verleiht der Ewigkeit dessen, was man eine Lebensform nennen könnte, Kraft oder nicht. Die Organisation der Begegnung ist die langsame und geduldige Entwicklung einer gemeinsamen Sprache, die sich von der des Kapitals unterscheidet und die nicht aus sich selbst heraus Sinn macht, sondern aufgrund der Erfahrung ihrer Entwicklung. Die Suche nach der Wahrheit hat also keine Bedeutung mehr relativ zu einer anderen, hegemonialen Wahrheit, sondern in Bezug auf den Aufbau von Beziehungen zwischen Wesen selbst. Es kann also mehrere Wahrheiten geben, ohne dass diese notwendigerweise versuchen, die anderen zu zerstören, sie zu subsumieren.
Die Revolution kann daher nicht mehr im öffentlichen Raum erscheinen, wenn sie nicht als Zerstörung desselben angesehen wird. Als Zerstörung ist sie die Errichtung einer Ebene der Immanenz, der Ebene der Lebensformen. Um es anders auszudrücken: Die Revolution ist nur noch der Moment, in dem die Öffentlichkeit in einen Bürgerkrieg umgewandelt wird. In gewisser Weise ist die Politik der Erfahrung, wenn sie zu so etwas führt, immer noch eine Eschatologie. Aber da die kommende Welt, der Bürgerkrieg, bereits da ist und von der Werbung überdeckt wird, wird die revolutionäre politische Aktivität in den Hintergrund gedrängt, d.h. als etwas, das nicht das primäre Ziel, sondern die Folge ist. Die Revolution bleibt, aber nicht das Revolutionäre als Lebensform.
3. Paradoxerweise geht es zwar vielleicht darum, bei sich selbst anzufangen – ohne dies jemals als politisches Ziel zu betrachten -, aber es geht vielleicht nicht darum, die Gesamtheit der eigenen Existenz mit einer politischen Bedeutung aufzuladen. Die Frage nach dem Ende der Politik zeugt von dieser letzten Sorge des Aktivisten, des Bürgers oder auch des böswilligen Aktivisten (d.h. des Aktivisten, der seit der Kritik des Militantismus militant ist), der in einem solchen Ende die ewige Wiederkehr der Frage „Warum bin ich hier?“ sieht. Wenn man dem folgt, was ich oben gesagt habe, kann sich eine Politik der Erfahrung keine öffentliche Existenz leisten, sondern ist zu einer gewissen Heimlichkeit gezwungen, was notwendigerweise bedeutet, dass sie nur auf ausgewählte, sporadische Weise als solche in Erscheinung tritt, außerhalb unserer verschiedenen sozialen Existenzen. Diese sind nicht nur Alibis oder Deckmäntel, sondern die Gesamtheit, die die Gelegenheiten, einander zu begegnen, strukturiert, oder vielmehr das, was es ermöglichen kann, einander zu begegnen, ohne sich verstecken zu müssen. Wir müssen also die situationistische Mythologie der perfekten Kohärenz zwischen politischer Aktivität und alltäglicher Existenz aufgeben. Eine solche Suche nach Kohärenz war übrigens die ständige Quelle einer allgemeinen Unzufriedenheit aller Individualitäten, die das radikale Milieu bevölkern. Das bedeutet keineswegs, dass wir keine Kritik am Alltagsleben aufrechterhalten, uns nicht über die sozialen Spiele, in die wir verstrickt sind, täuschen lassen oder alle Kompromisse akzeptieren. Diese Unterscheidung ist sowohl theoretisch als auch strategisch, damit die Organisation von Begegnungen nicht die Organisation von schlechten Begegnungen ist.
Theoretisch lässt sich eine Lebensform, die rein politisch wäre, leicht mit der des Kapitals identifizieren, wie dieses würde sie behaupten, außerhalb ihres eigenen Kontextes einen Sinn zu haben, eine Lebensform also, die in sich selbst einen Anspruch auf die Universalität ihrer Form erkennen lässt, dadurch bleibt sie ausnahmslos in der Sklaverei eingeschlossen, die nur schlechte Begegnungen herbeiführen kann. Diese Lebensformen, die das Kapital sowohl hervorgebracht hat als auch für seine eigene Reproduktion nutzt, können als die konkrete Ausarbeitung der Menschheit verstanden werden. Die Verabsolutierung des Individuums als leere Abstraktion ist außerhalb des Kontextes der Gesamtheit aller anderen Individuen auf dem Planeten bedeutungslos. Dies ist die „menschliche“ Lebensform. Die Unfähigkeit, sich selbst, allein oder mit anderen, außerhalb eines Kontextes der Totalisierung zu erfassen, entspricht der wohlwollenden Zustimmung zu einer Formulierung einer heimtückisch eschatologischen Politik.
Strategisch gesehen, und damit komme ich zum Schluss, ist die Trennung von der öffentlichen Sphäre eine Frage der Sicherheit. Der Zynismus, mit dem uns die Epoche jetzt erscheint, wird bald alle liberal-demokratischen Annahmen in Frage stellen, die all jene relativ schützten, die sogenannte revolutionäre Reden schwangen. Die Politik der Erfahrung und ihre Strategie der Begegnung müssen sich nicht öffentlich äußern, aber sie können die Unbeweglichkeit und die Einsamkeit nicht akzeptieren, die Traurigkeit, sich immer mehr in die Enge getrieben zu finden, um diese Welt zu akzeptieren und unter ihr zu leiden. Sie können also nicht das in den Vordergrund stellen, was in einem noch etwas liberalen Kontext möglich ist: sich zu bewegen, um diejenigen zu treffen, mit denen es noch etwas zu besprechen gibt, mit denen eine Begegnung möglich ist. Schließlich kann die Trennung der Politik vom öffentlichen Raum die Möglichkeiten für gute Begegnungen erhöhen, da die Aufmerksamkeit für den Körper, den eigenen und den der anderen, nicht mehr nur auf die Reden und die in der Öffentlichkeit geäußerten Absichten gerichtet ist, sondern auf das, was tatsächlich getan wird.
[Übersetzung aus dem Französischen]