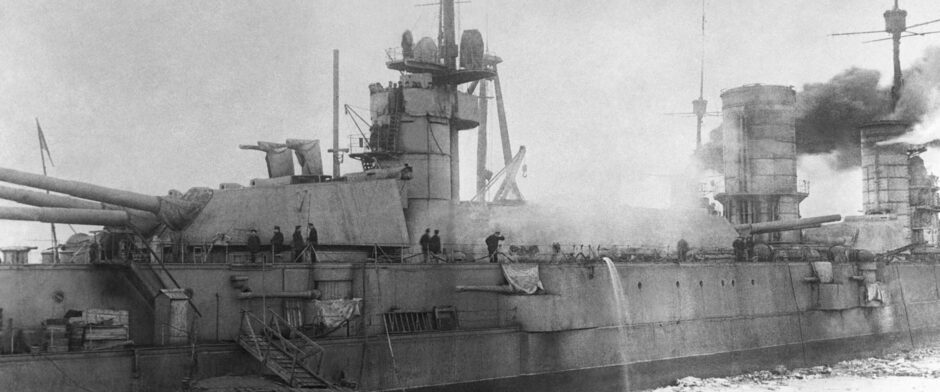Der folgende Text wurde von Nadja Meisterhans und Alexander Neupert-Doppler für einen Themenschwerpunkt “Strategien gegen rechts” angefragt, der in der Zeitschrift Berliner Debatte Initial erscheinen wird. Obwohl nicht nur auf “Strategien gegen rechts”, sondern auf das Ganze gegenwärtiger Herrschaftsstrategien bezogen, sollte der Artikel in der Zeitschrift auch erscheinen – unter der Bedingung allerdings, das die Passagen zum genozidalen Krieg gegen die Palästinenser*innen gestrichen werden: “Wir haben uns im Redaktionsteam darauf verständigt, dass wir uns an der diesbezüglichen Debatte nicht beteiligen werden”, heißt es wörtlich in der Stellungnahme der Redaktion. Besser kaum kann belegt werden, dass und wie die Unterwerfung unter die den Genozid mittragende deutsche Staatsraison bis weit in die Linke reicht. Besser kaum konnte belegt werden, dass die Unterwerfung bereits erfolgt, wenn der Staat der Staatsraison noch gar keine Druckmittel ausspielt: alle Beteiligten haben auch so verstanden, was “sich gehört.” Selbstverständlich habe ich die Einladung zur Teilhabe an der freiwilligen Knechtschaft zurückgewiesen: die autoritäre Verhärtung der herrschenden Verhältnisse hat am Genozid gegen die Palästinenser*innen ihr Modell. Deshalb ist es hier nicht erlaubt, “sich an der diesbezüglichen Debatte” nicht zu beteiligen.
Thomas Rudhof-Seibert
Dialektik der Zeitenwende. Versuch über das kommende Unheil.
Recht auf Konversion […]
der fortwährende Traum von der Antiphysis […]
Wir sind derart, dass sich das Mögliche
von uns aus vermöglicht.
Sartre 2005: 30f.
Vorbemerkung in eigener Sache
In Zeiten der Desorientierung kommt man um Versuche nicht herum, sich neu zu orientieren. Gelingen können sie nur in der Bereitschaft, rigoros Schlussstriche zu ziehen: Wer in scheinbar aussichtsloser Lage weiterkommen will, muss Ballast abwerfen, um von der Stelle zu kommen. Gut gezogen ist der Schlussstrich jedoch nur, wenn er das Denken nicht dümmer, nicht ärmer und nicht erbärmlicher macht. Das aber war oft der Fall, wenn Schlussstriche zum Marxismus gezogen wurden, jahrzehntelang die maßgebliche Theorie nicht nur des Widerstands, sondern darüber hinaus der Überwindung der bestehenden Gesellschafts- und Weltordnung und der sie tragenden politischen Kräfte. Ungezählt viele haben ihren Absprung aus dem Marxismus mit ihrer intellektuellen und ethisch-politischen Korruption, d.h. mit der einen oder anderen Version des Liberalismus bezahlt. Sich gut zu trennen, schließt deshalb – nur scheinbar paradox – Prinzipientreue in der Sache selbst des Denkens ein. Im hier verhandelten Trennungsfall gilt die Treue erstens der prinzipiellen Ablehnung der herrschenden Verhältnisse und aller ihrer Parteien: dass Karthago zerstört werden muss, ist die Wahrheit des Denkens, die im Folgenden außer Frage steht. Das schließt ein, dass es in diesem Beitrag zwar immer auch, doch nicht nur um Reflexionen auf den Widerstand gegen die politische Rechte gehen wird: Tendenzen auf eine autoritäre Verhärtung der Verhältnisse gehen heute nicht nur von der Rechten oder dem Rechtspopulismus, sondern von allen ihren politischen Lagern aus, besonders im Hinblick auf „Kriegsbereitschaft“ und „Kriegsfähigkeit“. Dem Marxismus noch in der Trennung treu zu bleiben, ist zweitens auch deshalb unumgänglich, weil er noch immer die die politische Phantasie beflügelt und grundiert, ohne die jeder Widerstand bloß defensiv bleiben wird, d.h. niemals zur Offensive kommt. Auf den Punkt gebracht: im Widerstand nicht nur gegen die Rechte, sondern gegen alle Kräfte der Beharrung dem Marxismus noch in der Trennung treu zu bleiben heißt, dem konkret-utopischen Horizont einer kommunistischen „Assoziation“ treu zu bleiben, „worin die freie Entwicklung einer jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“ Dies wird noch auf einem Planeten geboten sein, der weithin verwüstet sein wird. (Marx/Engels 1972: 482).
Dass die Verwüstung unausweichlich kommen wird, hat gerade der Marxismus früh schon für möglich gehalten. Sich in den Strategien des Widerstands von ihm zu trennen heißt deshalb, sich von dem Moment des marxistischen Denkens zu trennen, das sich seiner eigenen Einsicht in den Weg gestellt hat. Dies rigoros tun zu müssen, folgt aus dem Umstand, dass dieses besondere Moment gleichzeitig der Kerngedanke des Marxismus war und ist. Man sieht – eine gefährliche Sache: was darf der Widerstand um keinen Preis aufgeben, und wovon muss er sich selbst dann trennen, wenn der Verlust schmerzlich sein wird?
Wo also den Schnitt setzen?
War und ist die kommunistische Assoziation die Sache selbst des Marxismus, der hier weiter die Treue gehalten wird, so lag der Kerngedanke des marxistischen Denkens in der Bestimmung dieser Assoziation als einer in den herrschenden Verhältnissen bereits angelegten und von diesen Verhältnissen gleichsam selbst gewollten Sache. Anders als von nahezu allen anderen Kommunist*innen ihrer Zeit gedacht, war der Kommunismus für Marx und Engels gerade nicht „ein Zustand, der hergestellt werden soll, nicht ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben [wird]. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung.“ Von diesen Bedingungen nennen Marx/Engels an dieser Stelle zuerst das Proletariat als „die Masse von bloßen Arbeitern – massenhafte, von Kapital oder von irgendeiner bornierten Befriedigung abgeschnittne Arbeiterkraft.“ Die zweite, mit der ersten immanent verbundene Bedingung bezeichnen sie knapp als den „Weltmarkt“ und meinen damit natürlich den kapitalistischen Weltmarkt bzw., auf sein Ganzes bezogen, den auf die ganze Welt sich ausdehnenden Kapitalismus. Aus der inneren Einheit dieser beiden Bedingungen der „wirklichen Bewegung“ ergibt sich dann für das Proletariat und für den Kapitalismus, dass beide nur „weltgeschichtlich“ existieren können. Diese Bestimmung gilt dann nolens volens auch für den Kommunismus, der selbst ja gar nichts anderes als die (zugleich theoretische und praktische) „Aktion“ der wirklichen Existenz dieses Proletariats ist: „weltgeschichtliche Existenz der Individuen; d.h. Existenz der Individuen, die unmittelbar mit der Weltgeschichte verknüpft ist.“ (Marx/Engels 1978: 35f)
Richtig daran ist und bleibt noch heute, dass der „jetzige Zustand“ der Welt tatsächlich durch den Kapitalismus als das weltgesellschaftliche Verhältnis von Kapital und Arbeit „bedingt“ wird. Richtig ist und bleibt auch, die Möglichkeit einer Überwindung des Kapitalismus an die „weltgeschichtliche Existenz der Individuen“ zu binden – mit dem Akzent allerdings, vorab gesagt, auf dem Begriff der „Existenz.“ Falsch aber war und ist, auf den Punkt gebracht, diese Existenz in der Arbeit, der Arbeiterkraft und damit im Proletariat finden zu wollen.
Natürlich haben schon Marx und Engels und mit ihnen eine Vielzahl von Kommunist*innen geahnt, gerade hier einem optimistischen Fehlschluss verfallen zu sein – Engels zufolge soll schon Marx gesagt haben: „Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin.“ (Marx/Engels 1967: 388). Und doch haben die meisten Selbstkritiken des Marxismus bis auf den heutigen Tag an der Bestimmung des Kommunismus als einer „wirklichen Bewegung“ festgehalten, die in der Arbeit als dem „werktätigen Gattungsleben“ des produktiv mit dem Ganzen des Lebens geeinten Menschenwesens gegründet sei. (Marx/Engels 1968: 517) Zeigen lässt sich das noch an der letzten großen Selbstkritik des Marxismus, der von Antonio Negri und Michael Hardt eröffneten Theorie des biopolitischen Empires als des uns alle einschließenden weltgesellschaftlichen Verhältnisses. Kernmarxistisch ist diese Theorie zunächst einmal, weil sie eine Kritik der globalen politischen Ökonomie vorlegt, die tatsächlich die Möglichkeit bereitstellt, im Begriff des Kapitalismus die ganze Welt zu begreifen. Kernmarxistisch ist sie allerdings auch, weil sie den ebenfalls biopolitisch genannten Multituden als den Erb*innen des Proletariats das Vermögen zuschreibt, dem Empire und dessen politischen Parteien von rechts bis „links“ nicht nur Widerstand zu leisten, sondern sie von innen heraus auf den Kommunismus hin zu transzendieren. (Hardt/Negri 2000, 2004, 2010. Seibert 2009, 2017. Für einen Überblick vgl. Pieper/Atzert/Karakayali/Tsianos 2007) Wenn die Theorie des Empires und der Multituden deshalb der Ort ist, an dem im Denken des Widerstands der Schnitt zu setzen sein wird, dann liegt das bleibende Wahrheitsmoment dieser Theorie darin, das Empire als den Ort ausgewiesen zu haben, an dem der Schnitt auch praktisch zu setzen sein wird. Anders gesagt: der Widerstand gegen die rechtsautoritären wie überhaupt alle Tendenzen zur autoritären, gegebenenfalls faschistischen Verhärtung des Bestehenden muss in globaler, auch in geopolitischer Dimension gesucht werden: der Stadtteil ist nur insofern sein nächster Ort, als er im Ganzen der Welt platziert wird.
Das Empire im fünfundzwanzigsten Jahr des 21. Jahrhunderts
Als Hardt/Negri das Empire im Jahrhundertwechsel als unseren „jetzigen Zustand“ in den Blick nahmen, bezogen sie sich auf dessen damals aktuelle, in sich zugleich politische und ökonomische, darin aber auch kulturelle Durchsetzung. Politisch resultierte sie aus dem Sieg des Westens in der jahrzehntelangen Blockkonfrontation, den die Sieger*innen damals nicht ganz zu Unrecht als „Ende der Geschichte“ feierten. An die Stelle der west-östlich geteilten Welt trat eine planetare Weltordnung, die den Kapitalismus zum unüberschreitbaren Horizont allen Lebens gemacht hat und weiter machen will. Ökonomisch resultiert sie aus dem Umstand, dass sich der Kapitalismus damals von einem gesellschaftlichen Verhältnis des Kapitals und der Arbeit in ein Verhältnis des Kapitals zum Ganzen des Lebens verwandelt hat. Damit hing die Reproduktion des Kapitals nicht mehr nur an der ausbeuterischen Verwertung der Arbeit in der Fabrik, sondern an der ausbeuterischen Verwertung wortwörtlich jeder Lebensregung jenseits der hinfällig gewordenen Trennung von Produktion und Reproduktion einschließlich der von Arbeits- und „Freizeit.“ Maßgeblich dafür war und ist die systematisch fortschreitende Verwissenschaftlichung der Produktion, mit der die Arbeit nur noch insoweit die erste Produktivkraft bleibt, als sie in sich zur Kraft eines Wissens wird, das nicht nur die Arbeiter*innen, sondern tendenziell alle lebendigen Subjekte in der Nutzung der jeweils fortgeschrittensten Kommunikationstechnologien praktisch werden lassen. Diese zugleich räumliche und zeitliche Entgrenzung fassen Hardt/Negri im Begriff der „Biopolitik“ als einer Politik, deren Subjekt und Objekt der „bios“ selbst ist – das biopolitische Imperium des Ganzen von Leben und Welt einschließlich der ihm antagonistischen, ihrerseits ebenfalls biopolitischen Multituden. In diesem Begriff fassen Hardt/Negri die Entgrenzung des Proletariats zur Menge aller Mengen als dem Ganzen alles Lebenden.
Entgegen dem häufigsten Missverständnis geht es der Theorie des biopolitischen Empires nicht um die Ersetzung der nationalstaatlichen (us-amerikanischen, europäischen, sowjetischen bzw. russischen und chinesischen) Imperialismen durch ein globales Imperium. Ihr Thema ist vielmehr die wiederum systematische Überdetermination der fortdauernden innerimperialistischen Konkurrenzen und Konflikte durch die Nötigung aller Beteiligten zur gemeinsamen und darin eben imperialen Verwaltung des biopolitisch entgrenzten Weltmarkts: „Empire ist als Untersuchungsfeld in erster Linie durch die simple Tatsache bestimmt, dass es eine Weltordnung gibt.“ (Hardt/Negri 2000: 30). Auf sie haben sich alle politischen Kräfte zu beziehen – die rechten, die linken und auch die Kräfte der politischen Mitte. Während die politische Mitte mit ihrer Zugehörigkeit zur globalen Ordnung nie ein Problem hatte, spalteten sich hier sowohl die politische Rechte wie die politische Linke: Kräfte der Zustimmung zur „Globalisierung“ trennten sich von solchen der „Antiglobalisierung“ wie der „Globalisierungskritik.“
In methodischer Analogie zum alten Imperium Romanum schrieben Hardt/Negri diesem Empire eine dreistufige pyramidale Konstitution zu. An der Spitze platzierten sie die damals unangefochten welthegemoniale USA als Inhaberin cäsarischer Gewalt, darunter die Aristokratie (die anderen imperialen Mächte, die multinationalen Konzerne), am Sockel die plebejische Sphäre (die schwächeren Nationalstaaten, schwächere Kapitalgruppen, aber auch die UN, das System internationalen Rechts, die Öffentlichkeit einschließlich ihrer rechten wie linken politischen Parteien und sozialen Bewegungen). Von einer „Zeitenwende“ ist jetzt die Rede, weil diese Konstitution schon seit gestern „out of joint“ ist. Zur Verhandlung steht dabei aber nicht die Übergabe der cäsarischen Gewalt an einen neuen Träger, also nicht eine Ersetzung der USA durch China. Zur Verhandlung steht der Übergang von einer cäsarisch dominierten und in diesem Sinn unipolaren zu einer tatsächlich multipolaren Konstitution einer weiterhin biopolitisch-imperialen Weltordnung. Das ist deutlich komplexer und deshalb noch gefährlicher. (Neilson/Mezzadra: 2024) Dies umso mehr, als das imperiale Interregnum mit dem Anbruch der historisch ersten Weltkrise wortwörtlichen Sinnes zusammenfällt: mit dem Anbruch der ökologischen Krise, deren Besonderheit darin liegt, dass sie wie das Empire das Ganze des Lebens und der Welt umspannt. Dieser Spannweite wegen wird der Krisenhorizont, in dem wir alle uns bewegen, als Horizont einer „Vielfachkrise“ bezeichnet. Ihr greifen die Kriege voraus, die aktuell eben nicht gegen, sondern um das Empire geführt werden. An der Befürwortung dieser Kriege, der dazu notwendigen Aufrüstung und im gemeinsamen Versuch der gesellschaftlichen Durchsetzung einer in sich notwendig autoritären „Kriegsbereitschaft“ hängt die Konvergenz der politischen Kräfte, die von der politischen Rechten über die Mitte bis in „linke“ Strömungen reicht. Die Anzahl dieser Kriege wird vom Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung in seinem letztveröffentlichten Jahresreport (2023) auf insgesamt 369 gewaltsam ausgetragene Konflikte veranschlagt – Tendenz seit Jahren leicht, doch stetig ansteigend. (https://hiik.de/konfliktbarometer/aktuelle-ausgabe/). Das von dieser Zahl nur dürftig verborgene Grauen belegt, warum der Begriff der Biopolitik in sich mit dem der Nekropolitik zusammenfällt. (Dorsch: 2020) Exemplarisch kann dazu der aktuell fortdauernde Krieg gegen die Palästinenser*innen angeführt werden. Dessen imperialer und eben nicht bloß regional-imperialistischer Charakter zeigt sich im Gewährenlassen des Genozids durch ausnahmslos alle imperialen Mächte. Dass eben nicht nur die Israel politisch und militärisch verbundene NATO, sondern auch China, Russland und die Türkei den barbarischen Massakern wie der Ungeheuerlichkeit des strategischen Aushungerns einer ganzen Surplusbevölkerung letztlich tatenlos zusehen, erklärt sich aus dem Umstand, dass die Identifikation und Liquidation von „Terrorist*innen“ strategisch längst zum gemeinsamen Tagesgeschäft in der Aufrechterhaltung der Weltordnung als einer solchen geworden ist. Deren höchstgradig prekären Charakter haben Hardt/Negri schon 2000 in der bündigen Wendung gefasst: „Das Empire entsteht und zeigt sich als Krise.“ (a.a.O.: 36)
Zeitenwende I: Biopolitik der Pandemie
Wenn der Bestand des Empire trotz seiner nicht bloß gelegentlichen, sondern konstitutionellen Krisenhaftigkeit eben nicht durch die ihm antagonistischen Multituden in Frage gestellt wird, liegt das an dem Punkt, an dem Hardt/Negri den Grundirrtum Marx/Engels‘ wiederholen. Auch das lässt sich zunächst an den weltweit im livestream übertragenen Massakern der Israeli Defence Forces zeigen, denen nicht nur sämtliche imperialen Mächte tatenlos zusehen, sondern auch die Mehrheit ihrer Bürger*innen, die Hardt/Negri eben zu den Multituden rechnen. Natürlich wird weltweit gegen den Krieg protestiert. Doch verbleiben diese Proteste weit unterhalb des Niveaus, in dem sie das Geschehen politisch auch nur beirren könnten. Präziser gefasst: Sie haben die Passivität der Multituden nicht sprengen können, deren im Sinne Kants zu verstehendes „Geschichtszeichen“ in der Corona-Pandemie sicht- und lesbar wurde, mit der die kommende weltökologische Krise zur zugleich weltsozialen, weltökonomischen, weltpolitischen und weltkulturellen, also wortwörtlich weltgeschichtlichen, d.h. zur „Vielfach-Krise“ wurde. Zur Erinnerung in schnelllebiger Zeit:
Am 31. Dezember 2019 bestätigt China den massenhaften Ausbruch einer neuen Form der Lungenentzündung infolge der Infektion mit dem neu auftretenden Coronavirus 2019-nCoV, das wenig später in SARS-CoV-2 umbenannt wird. Einen Monat später ruft die Weltgesundheitsorganisation WHO infolge der rasanten Ausbreitung der bald mit dem Namen „Covid-19“ belegten Infektionskrankheit eine globale Gesundheitsnotlage aus. Sechs Wochen später wird Covid-19 zur weltweiten Pandemie erklärt. Das Recht dazu folgt aus der Zahl der Opfer, die zuletzt auf 18,3 Millionen geschätzt wird. Dass all‘ das damals ans Unfassbare grenzte, sei nicht bestritten. Dass das kaum zu Fassende zugleich infam war, zeigt die Impfkampagne, mit der die Gefahr eingehegt wurde: sie konzentrierte sich allein auf die reicheren Regionen des Imperiums und schloss die Bevölkerungen der armen Regionen ohne jedes politische Wimperzucken aus. Und doch. Und doch schlägt politisch genau besehen etwas ganz anderes zu Buche. Denn der Kern des biopolitischen Corona-Regimes lag – auf den Punkt gebracht – in der globalen Stillstellung des laufenden Alltagslebens wortwörtlich der Menschheit durch Einsperrung der Mehrheit der im selben Zug um ihre individuellen und kollektiven Grundrechte gebrachten Bürger*innen des Empire. Eingesperrt in ihre Wohnungen war ihnen der Kontakt zu allen Menschen untersagt, die sich nicht in derselben Wohnung befanden. Dieser historisch nie zuvor auch nur denkbare Durchgriff von Biomacht und Biopolitik auf das Leben einer jeden und perspektivisch aller blieb ohne jeden relevanten Widerstand. Damit ist nicht gesagt, dass die Kollektiveinsperrung nicht vernünftig gewesen sei, im Gegenteil: nach dem damaligen Stand der Kenntnisse schien sie zur Rettung des Lebens geboten. Doch ist sie auf dem Verwaltungswege, also bloß bürokratisch, und darin nach ärztlicher, d.h. primär naturwissenschaftlicher Expertise erfolgt – ohne Debatte durch den „demos“ und insofern nicht im Vollzug einer politischen Entscheidung. Mit einer solchen Entscheidung allein aber hätten sich die Unterworfenen in einem Sein behauptet, das mehr und anderes gewesen wäre als das Sein eines Lebewesens. Dass dies nur von einer Minderheit und in dieser Minderheit oft auf zutiefst hilflose und konfuse, wo nicht politisch rechte Weise getan wurde, nötigt dazu, diese im Wortsinn existenzielle Kapitulation als „Geschichtszeichen“ zu deuten. Der Begriff stammt von Immanuel Kant, der ihn anlässlich der Französischen Revolution geprägt hat. An ihr und ihrem Zeichen war Kant zufolge abzulesen, dass das „das Menschengeschlecht im Ganzen“ wenigstens der „Anlage“ nach zu einem unwiderruflichen „Fortschreiten zum Besseren“ befähigt sei. Er fand diese Anlage nicht nur bei den Teilnehmer*innen der Revolution, sondern auch und sogar mehr noch „in den Gemütern“ der „nicht selbst in diesem Spiele mit verwickelten“ Zuschauer*innen. Sie seien trotz der offenbaren Gewalttätigkeit des Ereignisses, ja trotz des mit ihm einhergehenden „Elends“ und sogar trotz der mit ihm einhergehenden „Gräueltaten“, so Kant, „von einer Teilnehmung dem Wunsche nach“ bestimmt gewesen, „die nahe an Enthusiasmus“ gegrenzt habe und dafür sorgen werde, dass sich „ein solches Phänomen in der Menschengeschichte“ nicht mehr vergessen wird. Derart unvergesslich bleibt es nicht nur den Zeitgenoss*innen des Ereignisses, sondern auch allen nachkommenden Generationen maßgeblich. (Kant 1984: 83). Von hier her muss die Biopolitik der Pandemie als Geschichtszeichen umgekehrten Sinnes verstanden werden. Niemals ist der Macht – ich spreche bewusst im Singularetantum – deutlicher vor Augen geführt worden, dass sie den Widerstand der Allermeisten schon im Ansatz ersticken kann, wenn sie die ihr Unterworfenen auf ihren möglichen Tod, damit aber auf ein Überleben verweist, um dessentwillen die Bedrohten sogar auf ihr Leben verzichten. Dass an dieser Stelle wie zuvor schon die Theorie der proletarischen Klasse so auch die der biopolitischen Multituden scheitert, sofern und solange sie als Klasse oder Menge der Arbeit und also des (Über-)Lebens, d.h. als biopolitische Klasse oder Menge gedacht werden, kann im knappen Verweis auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel gedacht werden. Bekanntlich lässt Hegel die Weltgeschichte in einer ebenso gewagten wie bahnbrechenden geschichtsphilosophischen Spekulation nicht mit dem Leben und der Arbeit, sondern mit einem Kampf auf Leben und Tod beginnen, in dem zwei menschliche Lebewesen einander handgreiflich zeigen wollen, mehr und anderes als nur ein Lebewesen zu sein. Dass sie das im Gang auf den Tod des jeweils anderen, damit aber auch im Wagnis ihres eigenen Todes tun müssen, entspringt der Sache selbst: ist ein Lebewesen durch seinen unbedingten Drang zur Selbsterhaltung bestimmt, zeichnet sich das freie Geistwesen durch die Möglichkeit aus, in der Selbstbehauptung seiner Freiheit noch gegen diesen Drang das eigene Leben „daranzusetzen.“ (Hegel 1970: 148, im Zusammenhang 145-155. Vgl. auch Kojève 1975 und Hegel/Seibert 2023). Allerdings zeigt der Verlauf des Kampfs, dass die Selbstbehauptung der Freiheit noch und gerade in der Gefahr des Todes zwar der erste Akt jedes Freiheitskampfs, deshalb aber notwendig „nur“ eine Möglichkeit ist. Hegel zufolge nimmt der Kampf ein vorzeitiges Ende, weil eine der beiden Kämpfenden auf ihre äußerste Möglichkeit verzichtet und sich des Überlebens wegen der Anderen unterwirft. Wenn sich die beiden Kämpfenden dann als Herr*in und als Knecht bzw. Magd trennen, hängt dies also nicht am Sieg der Herr*in, sondern an der Freiwilligkeit einer Knechtschaft, die den Tod vermeidet und das Leben verliert, um sich das Überleben zu sichern, das sie seither als Arbeitsleben führt. Liegt dialektischer Weise gerade hier das Recht, warum schon Hegel, dann Marx/Engels und zuletzt Hardt/Negri diesem Arbeitsleben seit der Französischen Revolution die Möglichkeit zuspekulierten, den Ausgang des geschichtsstiftenden Kampfes auf Leben und Tod durch dessen biopolitische Wiederholung zu revidieren, hat die millionenfache Unterwerfung unter das Corona-Regime das Geschichtszeichen gesetzt, das uns von diesem Irrtum befreit. Auf den Punkt gebracht: die Selbstbehauptung der Freiheit ist keine Möglichkeit des Arbeitslebens, sondern allein die Möglichkeit derer, die mit dem Leben, der Arbeit und damit aller Biopolitik zu brechen in der Lage sind. Sie allein realisieren, was Hegel über alles Leben hinaus den Geist nannte, der seit der materialistischen Umstellung des Denkens vom Kopf auf die Füße als „Existenz“ bezeichnet wird. Als lebendige Existenz vom Drang zur Selbsterhaltung dieses Lebens in die Arbeit „geworfen“, hat die ihr bloßes Leben transzendierende Existenz ihre äußerste Möglichkeit in der „Freiheit zum Tode“, d.h. im Vermögen, sich als freie Existenz gerade im Wagnis des Lebens zu behaupten. (Heidegger 1984: 266)
Zeitenwende II: Endzeitfaschismen
Allerdings führt uns die Freiheit zum Tode zumindest im ersten Schritt nur tiefer in das Problem des Widerstands gegen die eben nicht nur rechtspopulistischen Kräfte der autoritären Herstellung gesellschaftlicher Kriegsbereitschaft. Tatsächlich hat uns die Beschreibung des biopolitischen Empires nicht zufällig auf den paradigmatisch in Palästina ausgefochtenen „War on Terror“ geführt. In diesem Krieg geht das Empire seit dem 11. September 2001 gegen die politisch-militärischen Kräfte vor, von denen sein Bestand tatsächlich in Frage gestellt wird. Es sind dies eben nicht die politisch passivierten biopolitischen Multituden, sondern die zum Teil auf wenige todesbereite Einzelne beschränkten Minoritäten, die von den Polizeien des Empire oft zu Recht als „Terrorist*innen“ bezeichnet werden – wenn der Begriff hier in Anführung gesetzt wird, dann um anzuzeigen, dass er auch dann kein theoretischer, sondern ein Polizeibegriff ist, wenn ihm unstrittig ein Wahrheitsmoment zukommt: „Terroristisch“ agieren politische Gruppen, die strategisch auch und gerade deshalb allein auf den Schrecken (frz. terreur) setzen, weil die Schreckensherrschaft ihr tatsächliches politisches Programm ist. Dabei zeigen die Geschichte und mehr noch die Vorgeschichte des „War on Terror“, dass die „Terrorist*innen“ die Korruptionsform der politischen Figur sind, die bis ins spätere 20. Jahrhundert hinein zunächst als „Partisan*in“ oder „Guerillera“ bezeichnet wurde. Halten wir zunächst fest, dass Partisan*innen zu Recht überall dort zur Tat schreiten, wo der Widerstand gegen Unterdrückung, Ausbeutung und Missachtung nicht oder nicht zureichend vom Volk, der Klasse oder den Multituden geleistet wird – paradigmatisch sei dazu an die antifaschistischen Partisan*innen des Zweiten Weltkriegs erinnert. Dass die sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts durchsetzende Korruption der Partisan*innen zu „Terrorist*innen“ aus inneren und äußeren Gründen resultierte, kann nicht zufällig an den hier schon genannten palästinensischen Partisan*innen nachgezeichnet werden, die noch in den frühen 1980er Jahren mehrheitlich eben nicht islamistisch, sondern marxistisch ausgerichtet waren und auf eine soziale Revolution im gesamten Nahen Osten setzten. In dem Maß, in dem die weltgeschichtliche Situation ihnen jede Hoffnung auf die Durchsetzung ihrer ursprünglichen Befreiungs- und Freiheitsansprüche nahm, wurde die Korruption der ihnen eigenen „Freiheit zum Tode“ zu dem Schreckensprogramm, dessen bloß noch „terroristischen“ Charakter der 7. Oktober 2023 in grauenhafter Weise unter Beweis stellte. Der in den nächsten Tagen schon folgende Gegenangriff des „War on Terror“ zeigt seither in vielfach gesteigertem Grauen, dass der „Terrorismus“ die angestrebte Schreckensherrschaft verfehlt, weil die imperiale Gewalt ihrerseits vor dem Genozid der jeweiligen Surplusbevölkerung nicht zurückschrecken wird. Das beidseitige Dead End wird durch den Umstand noch einmal unterstrichen, dass nicht einmal das weltweite Livestreaming des gnadenlosen Ausbombardierens und In-den-Tod-hungerns von zwei Millionen Menschen die Multituden auf den Plan gerufen hat, die allein dem Spuk ein Ende bereiten könnten. Dieser „Terror von oben“ wird absehbar zum Paradigma ausnahmslos aller imperialen Mächte werden, die sich eigener „terroristischer“ Gefahren zu erwehren haben. Die aber werden mit dem Fortgang der weltökologischen Krise sprunghaft eskalieren, wobei der Begriff des „Terrorismus“ dann den Multituden zugesprochen werden wird, die durch die Verwüstung ihrer Lebensräume zur Migration in Gegenden des Empire gezwungen werden, die von der Krise nicht im gleichen Ausmaß betroffen sein werden. In besonderen Maß wird das vom europäischen Subimperium gelten, das sich deshalb auch systematisch einerseits der Liquidation noch der letzten Reste des Menschen- und Grundrechts der Freizügigkeit, andererseits einem historisch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unvergleichlichen Aufrüstungsprogramm verschrieben hat. Die eher früher als später mobilisierte europäische Armee wird ihre Feuertaufe allerdings nicht im Kampf gegen den russischen Erzfeind, sondern in der Militarisierung des Grenzregimes finden, dem schon heute jährlich Zehntausende zum Opfer fallen. Für unsere Fragestellung ist hier der Konsens von allesentscheidender Bedeutung, der rechte und rechtspopulistische, konservative, liberale, sozialdemokratische und grüne Kräfte jedenfalls im Grundsatz eint: die jüngste Aushöhlung des Migrationsrechts ist nicht unter einer rechten, sondern unter einer grün-sozialdemokratischen Regierung umgesetzt worden – mitsamt den begleitenden Programmen extremer militärischer Aufrüstung. Das Siegel darauf wird durch die fortschreitende Aushöhlung der politischen Form bürgerlicher Demokratie gesetzt, die in der weltweit wachsenden Gefahr der „Autoritarismen“ eher beredet als begriffen wird. Naomi Klein und Astra Taylor haben dazu den passenden Begriff des „Endzeitfaschismus“ geprägt, den sie als „monstrous, supremacist survivalism“ beschreiben. (Klein/Taylor 2025) Wenn sie sich selbst und uns deshalb die Aufgabe stellen, eine „Bewegung“ zu bilden, die „stark genug ist, sie zu stoppen“, muss dem entgegengehalten werden, dass gesellschaftliche Mehrheiten heute schon und absehbar erst recht übermorgen zwanglos dem Survivalismus zustimmen werden. Der aber ist wortwörtlich ein endzeitlich-biopolitischer Überlebenskampf: Doktrin des Imperiums, das in der bereits angebrochenen „Vielfach-Krise“ das „Survival of the fittest“ sicherstellen wird. Deshalb genau wurde diese Krise weiter oben als zugleich weltsoziale, weltökonomische, weltpolitische und weltkulturelle, also als wortwörtlich weltgeschichtliche Krise gefasst. Gleichen Sinnes fassen Klein/Taylor ihre Analyse der „apokalyptischen Anziehungskraft“ der Endzeitfaschismen so zusammen, dass sie sie als systemimmanent adäquate Antwort auf die ökologische Krise, auf deren Verdichtung in der Pandemie und auf den „raschen Fortschritt und die Übernahme von Künstlicher Intelligenz“ verstehen. Darin kommen Entwicklungen zusammen,
„die lange Zeit mit Science-Fiction-Schrecken vor Maschinen in Verbindung gebracht wurden, die sich mit rücksichtsloser Effizienz gegen ihre Macher wenden – Befürchtungen, die von denselben Leuten, die diese Technologien entwickeln, am stärksten zum Ausdruck gebracht wurden. All diese existenziellen Krisen kommen zu den eskalierenden Spannungen zwischen atomar bewaffneten Mächten hinzu.“ (A.a.O., meine Übersetzung) Obwohl ein Aufbruch der Multituden-Bewegung, auf die Klein/Taylor trotzdem setzen, nicht ausgeschlossen werden kann, soll hier jetzt ein anderer Einsatz ins Spiel gebracht werden.
Zeitenwende III: Die Existenz im Exodus
Am Beginn dieser Reise durchs Empire wurde von der Notwendigkeit gesprochen, den Schlussstrich unter eine Dialektik zu ziehen, die den Verwüstungen der lebendigen Arbeit in ihrem Verhältnis zum biopolitisch entgrenzten Kapital eine Biopolitik entgegensetzt, die auf eben diese lebendige Arbeit setzt. Unterwegs wurde deshalb auf eine Selbstbehauptung der Freiheit verwiesen, die keine Möglichkeit des Arbeitslebens, sondern allein die Möglichkeit derer sei, die mit dem Leben, der Arbeit und damit aller Biopolitik zu brechen in der Lage sind. Dabei wurde als Erbe des Begriffs des Geistes der Begriff der Existenz eingeführt, der zu einer Tradition des Denkens gehört, die der Denktradition von Marx und Engels zeitgleich ist. Wollte man den ethisch-politischen Einsatz dieser Tradition bündig fassen, so läge er darin, auf den nicht nur defensiven, sondern auch offensiven Widerstand weniger von Massen, sondern vieler entschieden Einzelner zu setzen. Aus jüngerer Zeit ist dem Philosophen Alain Badiou die Bemerkung zu danken, dass wir alle heute „den Zerfall der großen kollektiven Subjekte mitbekommen“ haben, „einen Zerfall, der wiederum im Denken stattfand.“ Dabei gehe es, so Badiou, nicht um die Frage, ob es diese Kollektivsubjekte gab oder gibt, sondern um die „Sättigung“ der Kategorien, die ihre Identifikation ermöglicht haben: „egal, ob es um Figuren von der Art des historischen Fortschritts der Menschheit oder um große Klassensubjekte – wie das Proletariat – geht, die als objektive Realitäten aufgefasst werden.“ Badiou schließt daraus, dass heute jeder und jede Einzelne, also jeder und jede Existierende, dazu aufgerufen sei, „im eigenen Namen zu entscheiden und zu sprechen.“ Dazu brauchen sie oder er, so Badiou, „einen festen Punkt, ein bedingungsloses Prinzip, eine gemeinsame Idee, die die ursprüngliche Entscheidung stützt und universalisiert.“ (Badiou 2016: 37f) Die hier exponierte These ist, dass dieser Punkt, dieses Prinzip oder diese Idee die Idee des Kommunismus ist und bleibt. Dazu darf er allerdings, an dieser Stelle gegen Marx und Engels, nicht mehr als „wirkliche Bewegung“, sondern muss als ein „Zustand“ gefasst wird, „der hergestellt werden soll“, also als „ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird.“ Vom frommen Wunsch unterscheidet sich die Idee des Kommunismus, wenn die Wirklichkeit und Wirkmächtigkeit der „Entscheidung“ aufgewiesen werden kann, an die Badiou diese Idee zu Recht gebunden hat. Wo aber und vor allem wie wird diese Entscheidung wirklich und wirkmächtig gefällt? Ihr Ort ist kein anderer als die Existenz, die begriffsgeschichtlich mit dem Geist, dem Leben und der Arbeit ins Denken getreten ist. Sie hat ihren eigenen Ort in der „Geworfenheit“ zugleich in den Geist, das Leben und die Arbeit, in der und in denen sie wirklich und wirkmächtig wird, sofern sie mit ihr (der Geworfenheit) und mit ihnen (dem Geist, dem Leben und der Arbeit) bricht. Jean-Paul Sartre hat diese Existenz deshalb als das „absolute Ereignis“ und als „Faktum des Dem-Faktum-Entgehens“ (838), darin aber systematisch als die eigentliche „menschliche-Realität“ bezeichnet (Sartre 1991: 77 bzw. 838, vgl. auch 1058, 1061. Der Begriff „menschliche-Realität“ zieht sich durch das ganze Buch). Wenn das Ereignis dieser „menschlichen-Realität“, so Sartre weiter, „diasporischen“ (266) und also „expatriierten“ (854) Wesens sei, so ist das wortwörtlich zu nehmen. Im Widerstand nicht nur gegen die rechten, sondern gegen alle tragenden Kräfte der autoritären und katastrophischen Tendenzen im biopolitische Empire ist das Diasporisch- und Expatriiert-sein der „menschlichen-Realität“ – nur scheinbar paradox – wortwörtlich zu nehmen. Das Leben wagend und der Arbeit sich entziehend, begibt sich die Existenz auf einen Exodus, d.h. auf einen Auszug aus der Wüste der Knechtschaft, der im Überall und Nirgends des Empire immer jetzt und hier sein kann (Buch Exodus, 1–15): überall dort also, wo die „menschliche-Realität“ der Wahrheit ihrer Existenz begegnet. Exemplarisch wird das überall und jederzeit dort der „Fall“ sein, wo es darum geht, den „Endzeitfaschismen“ Widerstand entgegenzusetzen – im eigenen Namen und mit den eigenen Worten.
Zur Konkretion dieser Selbstbegegnung wurden hier vorab schon an die Partisan*innen erinnert. Stellt die „Terrorist*in“ die Korruptionsform dieser Existenzfigur dar, so stellt die diasporische und expatriierte Existenz-im-Exodus deren Idealform dar. Sie ist dies auch und gerade deshalb, weil sie nicht notwendig zur Waffe greift, sondern ihren Kampf in ganz verschiedenen Weisen führt: unauffällig im Hinterland des Feindes, das im Empire schon deshalb überall und nirgends ist, weil es räumlich und zeitlich kein Außen mehr kennt. Wie die Partisan*in kämpft auch die Existenz-im-Exodus im eigenen Namen und also auf eigene Entscheidung, sucht dabei aber stets die freie Verbindung zu anderen Existierenden, die wie sie im Empire expatriiert wurden oder, besser noch, sich dort expatriiert haben. Dabei stützt sie ihre Existenzpolitik auf die Quellen, auf die sich die Freiheit immer gestützt hat, weil sie ihre eigenen Quellen sind: auf die Philosophie, das Wissen, die Kunst – und auf die Liebe, zu der sich mit Glück je zwei Existierende finden. Natürlich kann gegen diesen Partisanenkampf erweiterten Sinnes sofort eingewendet werden, dass er in seiner Vereinzelung auf wenige „weltgeschichtliche Individuen“ das Empire gar nicht überwinden und seine katastrophischen Tendenzen nicht einmal bremsen kann. Doch ist dem entgegenzuhalten, dass die Unüberwindlichkeit imperialer Herrschaft gerade den Ausgangspunkt und besonderen Einsatz dieses Kampfes bilden: Er wird ja bewusst und entschieden auf verlorenem Posten begonnen. Wenn der Exodus der Existenz das Empire nicht stürzt, bevor es sich selber gestürzt haben wird, so prägt er dem Empire doch den allesentscheidenden Unterschied ein: den Unterschied, der seinen Prozess eben zu mehr und zu etwas ganz anderem als nur zu einem biopolitischen Prozess macht, weil er ihn auch zu einem Prozess der Freiheit macht. Das kann reichen, um den Einsturz des „stahlharten Gehäuses der Hörigkeit“ (Max Weber) in Freiheit zu überstehen und nach dessen Untergang anderen das Beispiel eines freien Akts zu geben. Bindet sich die Existenz dabei auch alltäglich-praktisch an die in der Idee des Kommunismus geborgene Möglichkeit ihrer freien Assoziation, so schafft sie diesem Kommunismus die ihm einzig angemessene Wahrheit eines konkret-utopischen Existenzideals, „nach dem die Wirklichkeit sich zu richten haben wird.“
Literatur
Badiou, Alain (2016): Philosophie des wahren Glücks. Wien: Turia und Kant.
Dorsch, Timo (2020): Nekropolitik: Neoliberalismus, Staat und organisiertes Verbrechen in Mexiko. Wien: Mandelbaum.
Hardt, Michael/Negri, Antonio (2000). Empire. Die neue Weltordnung. Frankfurt: Campus.
Hardt, Michael/Negri, Antonio (2004). Multituden. Krieg und Demokratie im Empire. Frankfurt: Campus.
Hardt, Michael/Negri, Antonio (2010). Common Wealth. Das Ende des Eigentums. Frankfurt: Campus.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1970): Phänomenologie des Geistes. Frankfurt: Suhrkamp.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2023): Herrschaft, Knechtschaft, Bewusstsein der Freiheit. Eingeleitet und kommentiert von Thomas Seibert. Hamburg: Galerie der abseitigen Künste.
Heidegger, Martin (1984): Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer.
Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (2023): The Conflict Barometer 2023. URL https://hiik.de/konfliktbarometer/aktuelle-ausgabe/ (Zuletzt aufgerufen 06.06.25).
Kant, Immanuel (1984): Der Streit der Fakultäten. Leipzig: Reclam.
Klein, Naomi/Taylor, Astra (2025). The rise of end times fascism. In. The Guardian, 13.04.2025. URL https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2025/apr/13/end-times-fascism-far-right-trump-musk?fbclid=IwY2xjawKFR59leHRuA2FlbQIxMQABHn9mB4IbAne5w83uHzcgpepPVw69NPw1diKlxvhVBNtcvVuNDtx023gvfKG5_aem_lC9YrrkIrnjvHLN0MaFJcw&sfnsn=scwspmo (Zuletzt abgerufen 06.06.25).
Kojève, Alexandre (1975). Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens. Frankfurt: Suhrkamp.
Marx, Karl/Engels, Friedrich (1967): Briefe Januar 1881 – März 1883. Marx-Engels-Werke Bd. 35. Berlin/DDR: Dietz.
Marx, Karl/Engels, Friedrich (1968): Ökonomisch-philosophische Manuskripte. Ergänzungsband. Schriften bis 1840. Erster Teil. Berlin/DDR: Dietz.
Marx, Karl/Engels Friedrich (1972): Manifest der Kommunistischen Partei. Marx-Engels-Werke Bd. 4. Berlin/DDR: Dietz.
Marx, Karl/Engels, Friedrich (1978): Kritik der deutschen Ideologie. Marx-Engels-Werke Bd. 3. Berlin/DDR: Dietz.
Neilson, Brett/Mezzadra, Sandro (2024): The Rest and the West. Capital and Power in the Multipolar World. London: Verso.
Pieper, Marianne/Atzert, Thomas/Karakayali, Serhat/Tsianos, Vassilis (2007) Empire und die biopolitische Wende. Die internationale Diskussion im Anschluss an Hardt und Negri. Frankfurt: Campus.
Sartre, Jean-Paul (2005): Entwürfe für eine Moralphilosophie. Hamburg: Rowohlt.
Sartre, Jean-Paul (1991): Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Hamburg: Rowohlt.
Seibert, Thomas (2009): Krise und Ereignis. Siebenundzwanzig Thesen zum Kommunismus. Hamburg: VSA.
Seibert, Thomas (2017): Zur Ökologie der Existenz. Freiheit, Gleichheit, Umwelt. Hamburg: Laika.