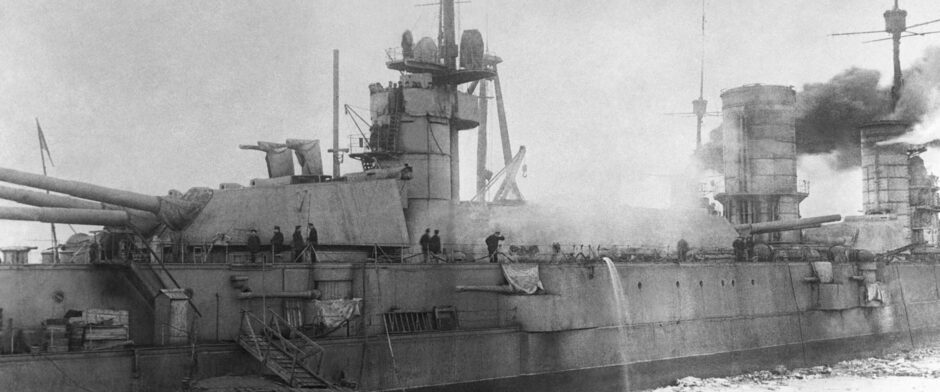Vorbemerkung:
Leider konnte Achim Szepanski nicht persönlich zum Non-Kongress kommen. Wir haben ihn also nach bestem Wissen und Gewissen anhand von Zitaten aus seinen Texten mit dem Text „Zeit der Ökologie“ ins Gespräch kommen lassen. Die Veröffentlichung hier erfolgt nach seinem Tod. Wir gedenken seiner.
Zitat-Gespräch:
Achim Szepanski hat eine kritische Position gegenüber der These des neuen ökologischen Akkumulationsregimes. Er spricht den grünen Technologien als Modernisierungsinnovationen nicht die notwendige Potenz zu, da die Krisensituation zu gravierend ist, als dass es in ihr eine dem Kapitalismus immanente Rekonfiguration geben könnte.
Hierzu schreibt er:
„Die durch alle Medien, von links bis rechts, von der Neoklassik bis zum Postkeynesianismus geisternde Debatte Stimulus versus Austerität bescheinigt den Staaten unverdrossen die Potenz, Krisen noch lösen zu können, nur ist diese längst erschöpft. Die Profitraten in der Industrie stagnieren, während das ekstatische Wachstum des spekulativen Kapitals die Kluft zwischen orbital zirkulierendem Geldkapital und dem durch die Ausbeutung der Arbeitskraft geschaffenen Mehrwert ständig vergrößert.“
„Im Gegensatz zur Medizin, in der die Krise die Heilung auslösen soll und damit verschwindet, geht die gegenwärtige Polykrise anscheinend nicht vorbei, vielmehr scheint sie in Permanenz zu delirieren, ohne jeden Ausweg, alternativlos wie der Kapitalismus selbst. Darin liegt für Marxisten die makroökonomische Implikation, dass Krisen im heutigen Kapitalismus zumindest ihre reinigende Funktion verloren haben; das Kapital braucht sie vielmehr, um seine chronische Ohnmacht zu verbergen. Was sich also ändert, ist die epistemische Funktion der Krise,“ die er als Polykrise mit sich verschränkenden Teilen beschreibt.
Die Rationalität des Modellierbaren, des Wissbaren und des Vorhersehbaren würde zusammenbrechen in der Polykrise. Deshalb ist ein gewollter Sprung mit der grünen Technologie aus dieser Perspektive nicht machbar: dem Kapitalismus ist angesichts der Polykrise keine „Heilung“ möglich durch ein grünes Wachstum, durch ein ökologisches Akkumulationsregime.
Zudem zeichne die Polykrise aus: „In Zeiten der Katastrophe vermischen sich Realität und Fiktion. Der globale Informationskrieg ist derzeit angesichts des Ukraine- und des Gaza-Krieges in vollem Gange. Verschiedene Versionen der Realität prallen immer offener aufeinander. Es gibt nicht mehr wie in der alten Welt nur eine Realität. Das ist genau das, was Baudrillard unter Hyperrealität versteht.“ Darin wird der »homo catastrophicus« produziert. Hier liegt sicherlich eine Gemeinseinsamkeit von „Zeit der Ökologie“ mit Szepanski vor, da der »homo catastrophicus« auch als Träger eines Ökologischen Akkumulationsregimes bezeichnet werden kann.
Achim Szepanskis Grundbeobachtung lautet: „Der Weltkapitalismus scheint in einen paradoxen, einen beschleunigenden und zugleich erschöpfenden Panik-Modus übergegangen zu sein, in dem die Ekstatik des Über als Überakkumulation und Überspekulation auf die destruktiven Aktivitäten des Kapitals trifft, insbesondere hinsichtlich der Kapitalisierung der Natur und der Erzeugung einer globalen Surplus-Bevölkerung.“ Das Über würde auch wirkmächtig in der nichtlinearen Entwicklung der Überverschmutzung, wie es die Geschichte des Kapitalismus aufzeigt: jedes neue ökologische Regime hat nicht nur mehr Abfall produziert, sondern auch qualitativ neue und giftigere Formen von Abfall.
Statt am Horizont ein grünes Modernisierungsprojekt des Kapitalismus ausmachen zu können ist aus Szepanskis Sicht vor allem die (Über-) Spekulation das Fundament weiterer Entwicklung. Er schreibt:
„Mit der Ekstatik des spekulativen Kapitals verschwindet die fordistische Produktion der Fabrik im globalen Norden, um in allen möglichen Wucherungen im globalen Süden weiter zu existieren. Unterdessen kündigt das finanzielle Kapital den Sieg einer schwerelosen digitalen Ökonomie an, die sich einerseits von der „Realökonomie“ weitgehend befreit hat und sich der autoreferentiellen Spekulation überlässt, und andererseits die Realökonomie an den Finanzmärkten immer wieder kontrollieren muss, so dass von einer absoluten Loslösung des finanziellen Kapitals gegenüber dem Industriekapital nicht gesprochen werden kann. Es ist aber nicht die Realökonomie, welche die Finanzökonomie vorantreibt, sondern es ist umgekehrt die Finanzökonomie, welche die Realökonomie strukturiert. Dabei gilt es stets zu berücksichtigen, dass der „Wert“ eines finanziellen Investments dem kapitalistischen Produktionsprozess nicht nachgeordnet ist, sondern ihm vorausgeht. Er existiert nicht, weil Mehrwert produziert wurde, sondern weil das finanzielle Kapital zuversichtlich ist, dass die Realisierung von Renditen in der Zukunft stattfinden wird. […]
Derivate stehen heute im Mittelpunkt der Spekulation, und sie sind bis zu einem gewissen Grad vom Preis des zugrundeliegenden Vermögenswerts, wie z. B. Öl, abgekoppelt, wenn auch nicht völlig entkoppelt. Es werden heute wesentlich mehr Derivate und Terminkontrakte ge- und verkauft als Barrel Öl gehandelt werden.“ …und erst recht als mit Solarpanels und E-Autos gehandelt wird.
Aus Achim Szepanskis Analyse stellt sich die Frage an die Position des ökologischen Akkumulationsregimes: Ist überhaupt damit zu rechnen, dass sich ein neues Akumulationsregime innerhalb des krisenhaften Kapitalismus entwickeln kann – verfügt der niedergehende Neoliberalismus noch über die notwendige Kraft, eine neue Form der kapitalistischen Verstetigung unter dem Paradigma der Ökologie zu entwickeln? Oder läuft alles auf eine Implosion hin, in der es kein Danach gibt?